Energiesysteme und -effizienz,
Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz
Ein Schweizer Pionier der Holzenergie geht in Pension

Thomas Nussbaumer wurde auf Ende Sommersemester 2025 pensioniert. 40 Jahre hat er der Bioenergie gewidmet – in Forschung und Lehre. Die letzten 18 Jahre an der Hochschule Luzern – Technik & Architektur. Was bleibt? Ein Überblick.
Thomas Nussbaumer, 1960 in Zürich geboren, gehört zu den prägendsten Persönlichkeiten der Bioenergie-Forschung im deutschsprachigen Raum. Nach dem Studium des Maschinenbaus und der Verfahrenstechnik an der ETH Zürich schloss er 1984 mit dem Diplom ab und promovierte 1989 über die Schadstoffbildung bei der Holzverbrennung. 1990 gründete er die Forschungs- und Beratungsfirma Verenum, die auf Bioenergie und Feuerungstechnik spezialisiert ist. 1999 habilitierte er sich im Bereich thermochemische Biomassenutzung an der ETH. Von 2007 bis 2025 war er Professor für Erneuerbare Energien an der Hochschule Luzern und leitete dort die Forschungsgruppe Bioenergie. Neben seiner akademischen Tätigkeit engagierte er sich ab 1990 als Vertreter der Schweiz in der Internationalen Energieagentur (IEA Bioenergy Task 32) und als Initiator des Holzenergie-Symposiums, das Wissenschaft, Politik und Praxis zusammenbringt.
Seine Eigenschaften prädestinieren Holz zum Einsatz für Prozesswärme und für eine Nutzung zur Deckung von Bedarfsspitzen an Gebäudewärme im Winter
Thomas Nussbaumer
Seine Erkenntnisse bringen eine Branche voran
Im Zentrum von Nussbaumers Forschung steht die saubere und effiziente Nutzung von Holz als Energieträger. Schon seine Dissertation legte die Grundlagen für ein besseres Verständnis der Schadstoffbildung in Holzfeuerungen. Er konnte zeigen, wie Faktoren wie Holzfeuchte, Luftzufuhr und Temperaturprofil die Entstehung von Kohlenmonoxid, Stickoxiden und flüchtigen Kohlenwasserstoffen beeinflussen. Diese Erkenntnisse führten zu neuen Konstruktions- und Regelungsstrategien für emissionsarme Holzfeuerungen und Heizwerke. In späteren Arbeiten entwickelten er und sein Team auch mathematische Modelle für Festbettfeuerungen, die es ermöglichen, Verbrennungsprozesse zu simulieren und Anlagen zu optimieren.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Partikel- und Feinstaubreduktion. Nussbaumer erforschte die Bildung von Aerosolen in Holzfeuerungen, identifizierte zentrale chemische Vorläufer und entwickelte Primärmassnahmen zur Minderung von Partikelemissionen. Diese Forschung ebnete den Weg für moderne Elektroabscheider und innovative Brennraumkonzepte, die heute in vielen automatischen Holzheizungen eingesetzt werden. Seine Studien zum Vergleich verschiedener Systeme belegten zudem, dass moderne automatische Anlagen mit guter Regelung deutlich geringere Emissionen aufweisen als handbeschickte Feuerungen – eine wichtige Grundlage für strengere Luftreinhaltevorschriften und Förderprogramme.
Die nächste Generation an Ingenieurinnen und Ingenieuren sollte der Gesellschaft nicht nur aufzeigen, welche technischen Verbesserungsmöglichkeiten noch bestehen, sondern auch, welche Fortschritte durch Veränderung der politischen Rahmenbedingungen und des Verhaltens möglich sind.
Thomas Nussbaumer

Schon früh wird’s grundsätzlich
Neben der reinen Technik rückte Nussbaumer bereits vor über 20 Jahren die System- und Ressourcenperspektive in den Fokus. In einem Vergleich von «Wärme, Strom oder Treibstoff aus Holz» (2005) zeigte er auf, dass Holz für Wärme und Wärme-Kraft-Kopplung einen höheren Nutzen für die Energieversorgung erzielt als wenn Holz zu Treibstoff umgewandelt und zur Mobilität genutzt wird. Im Auftrag des Bundes verglich er viele Jahre später noch einmal die verschiedenen «Verwertungspfade Holzenergie» und deren Ressourceneffizienz (2023). Daraus leitete er ab, dass Energieholz im Gebäudebereich künftig nur noch zur Spitzenlastdeckung im Winter eingesetzt werden sollte, um das restliche Holz zur Erzeugung von Prozesswärme zu reservieren, für die bis anhin fossile Energieträger eingesetzt werden.
Im White Paper «Energieholz in der Schweiz» (2023) analysierte er zusammen mit Partnern daneben das energetische Potenzial von Waldrestholz, die technologische Entwicklung und die Rolle von Holzenergie in der Energiewende. Das wichtigste in Kürze:
- Ressourcenpotenzial: Schweizer Wälder bieten ein nachhaltiges Energieholzpotenzial auf, das nur noch geringfügig erhöht werden kann und deshalb gezielt genutzt werden sollte. –> Grundlage für Energiestrategien und politische Entscheidungsprozesse.
- Technologieentwicklung: Fortschritte bei automatischen Rostfeuerungen ermöglichen den Einsatz von Brennstoffen variabler Qualität. –> Erhöht die Flexibilität und Wirtschaftlichkeit von Holzenergie.
- Klimarelevanz: Holzenergie kann fossile Energieträger ersetzen, wenn nachhaltige Bewirtschaftung und Emissionsminderung gewährleistet sind. –> Verbindet Energie- und Klimapolitik zu einem ganzheitlichen Ansatz.
Das Fazit
Mit konsequenter Mobilisierung der Ressourcen und emissionsarmer Technik kann die Holzenergie ihren Beitrag zur Energieversorgung der Schweiz noch deutlich erhöhen. Allerdings muss Energieholz für hochwertige Anwendungen reserviert werden, für die eine Substitution fossiler Energien mit anderen erneuerbaren Energien schwierig ist. Dies betrifft in erster Linie die Bereitstellung von Prozesswärme und von Spitzenlast-Gebäudewärme.
Interview mit Thomas Nussbaumer

Thomas, wenn du auf deine berufliche Laufbahn zurückblickst, welches Gefühl kommt dann auf?
Thomas Nussbaumer: Ich empfinde Befriedigung und Stolz dafür, dass ich etwas erreicht und bewirkt habe. Daneben empfinde ich aber auch Dankbarkeit und Freude über die Kontakte zu vielen interessanten Menschen, die mich auf meinem Weg unterstützt und begleitet haben.
Welche Forschungsfrage hat dich am längsten begleitet oder am meisten interessiert?
Am längsten begleitet hat mich die Frage, wie die Schadstoffe bei der Holzverbrennung gebildet werden und wie sie reduziert werden können. Im Verlauf der Jahre habe ich mich daneben immer mehr auch mit der Frage befasst, wie und wofür wir Holz und andere Ressourcen einsetzen sollten, damit sie einen maximalen Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung erzielen. Da Holz nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, geht es im Falle der Holznutzung um eine Priorisierung mit der Frage, wieviel Energieholz für welche Anwendung genutzt werden soll, wobei Gebäudewärme, Prozesswärme, Elektrizität, Treibstoffe oder Kohlenstoffsenken zur Diskussion stehen.
Was ist im Bereich Bioenergie in der Schweiz noch zu tun, um dessen Ressourcenpotenzial auszuschöpfen?
Da das nachhaltige Potenzial an Energieholz bereits zu etwa 80 % ausgeschöpft ist, müssen wir Holz künftig so einsetzen, dass es den maximalen Nutzen für das Gesamtsystem erzielt und Solar- und Windenergie optimal ergänzt. Dazu sind zwei Eigenschaften von Holz zentral, nämlich die Möglichkeit, sehr hohe Temperaturen zu erzeugen und die Möglichkeit, den Energieinhalt über längere Zeit zu speichern. Die erste Eigenschaft prädestiniert Holz zum Einsatz für Prozesswärme und die zweite für eine Nutzung zur Deckung von Bedarfsspitzen an Gebäudewärme im Winter.
Du hast an der HSLU auch Studierende ausgebildet. Was ist dein Eindruck von der nächsten Generation von Bioenergie-Expert:innen?
Bei meinem Start in die Berufstätigkeit wurde die Bioenergie noch eher belächelt und die Techniken waren teilweise noch sehr einfach. Dies ist heute ganz anders. Die Grundlagen zur Nutzung von Biomasse sind bekannt und es gibt eine Vielzahl von kommerziell verfügbaren Technologien. Studierende mit Wahlfach Bioenergie sind mit diesen Technologien vertraut und in der Lage, entsprechende Anlagen zu konzipieren und mit ihrem Wissen zur Nutzung des Potenzials der Bioenergie beizutragen.
Und was ist dein Wunsch an sie?
Mein Wunsch ist, dass die nächste Generation an Ingenieurinnen und Ingenieuren das vorhandene Wissen kompetent einsetzt. Zusätzlich wünsche ich mir, dass sich diese gut ausgebildeten Fachleute im späteren Leben immer wieder Zeit dafür nehmen, die Entwicklung der Gesellschaft kritisch zu hinterfragen und sich Gedanken zu machen, ob wir unsere Ressourcen auch wirklich sinnvoll nutzen. Wo dies möglich ist, sollten sie der Gesellschaft nicht nur aufzeigen, welche technischen Verbesserungsmöglichkeiten noch bestehen, sondern auch, welche Fortschritte durch Veränderung der politischen Rahmenbedingungen und des Verhaltens möglich sind.
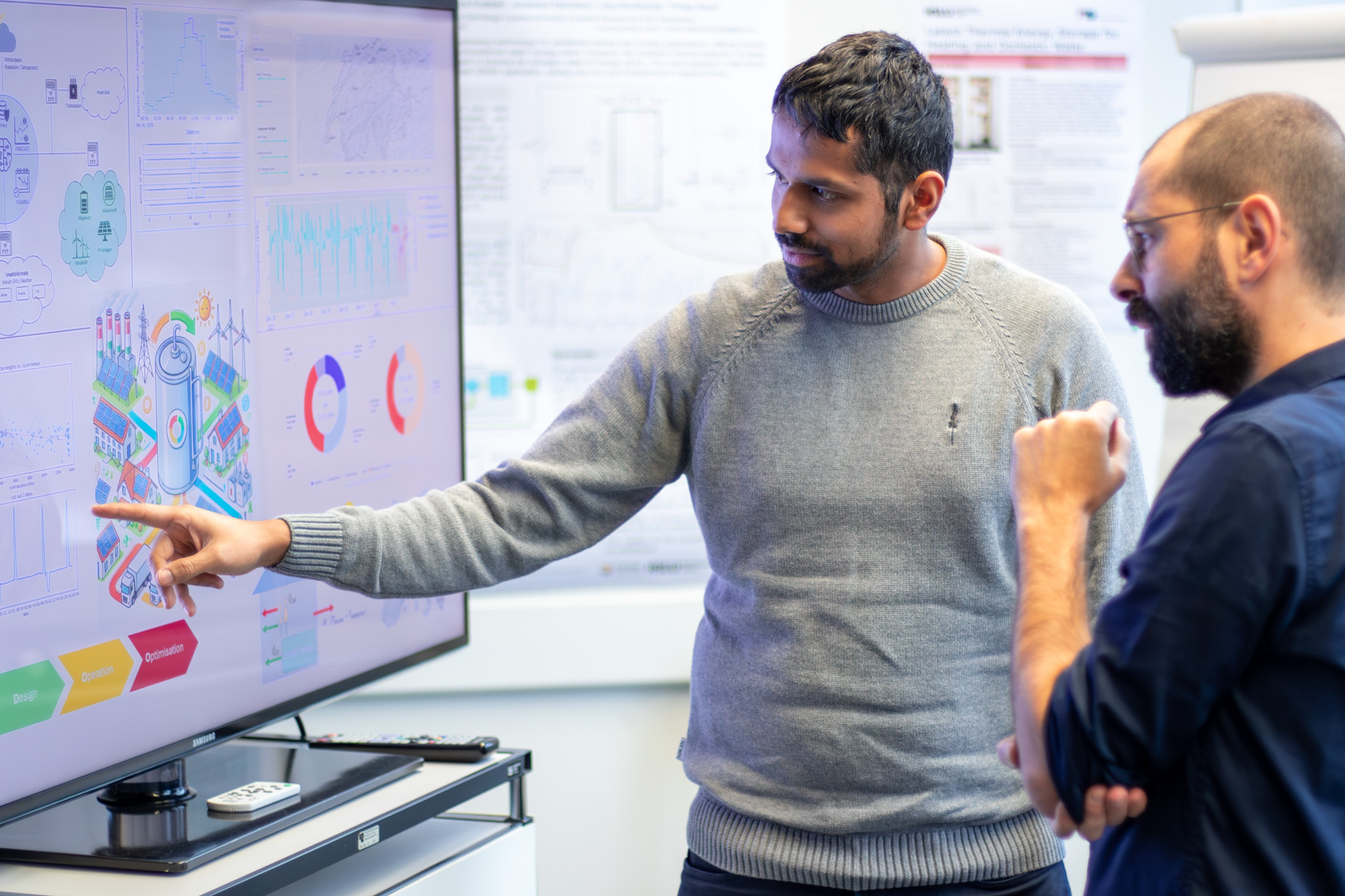


Kommentare
0 Kommentare
Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.