Tugenden stärken: Warum Wertearbeit Gemeinden erfolgreicher macht

In der öffentlichen Verwaltung zählen nicht nur Fachwissen und Prozesse. Tugenden wie Verlässlichkeit, Empathie und Integrität sind zentrale Ressourcen für Vertrauen, Zusammenarbeit und Gemeinwohl. Dieser Beitrag zeigt, wie Mitarbeitende und Führungskräfte Tugenden gezielt fördern können — auch mit knappen Ressourcen.
«Betrachte den Menschen als ein Bergwerk reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert.» Dieser Gedanke erinnert uns daran: Jeder Mensch verfügt über positive innere Eigenschaften – Tugenden wie Empathie, Verantwortungsbewusstsein, Integrität oder Geduld. In der Arbeitswelt werden solche Qualitäten selten explizit thematisiert, obwohl sie erheblich zu Motivation, Zusammenarbeit und Leistungsfähigkeit beitragen können.
Tugenden sind keine fixen Eigenschaften, sondern Potenziale, die entwickelt werden können – vergleichbar mit Kompetenzen. Tugenden richten sich jedoch nicht primär auf individuelle Leistung, sondern auf das grössere Ganze: den Beitrag zum Team, zur Organisation und letztlich zum Gemeinwohl. Dafür braucht es ein Menschenbild, das auf Ressourcen statt auf Defizite fokussiert und Mitarbeitende nicht nur als Funktionsträger:innen, sondern als mitgestaltende Persönlichkeiten ernst nimmt. Das sogenannte Growth Mindset, also die Überzeugung, dass man durch Engagement und Übung dazulernen und sich weiterentwickeln kann, schafft eine solide Grundlage, Tugenden im Berufsalltag zu fördern. Wenn Mitarbeitende einer Gemeinde beginnen, sich regelmässig und niederschwellig konstruktives Feedback zu geben, stärkt dies nicht nur individuelle Tugenden wie Verantwortungsbewusstsein oder Integrität, sondern fördert auch eine Kultur des Vertrauens und der Mitgestaltung. Mit der Zeit wird Feedback zur Gewohnheit und man lernt, differenzierter wahrzunehmen und präziser zu formulieren, was man an Kolleg:innen schätzt – und ebenso, wo man sich ein anderes Verhalten wünschen würde. Dabei ist wichtig, auf Verallgemeinerungen zu verzichten («Du bist immer…»), Rückmeldungen konkret und situationsbezogen zu geben sowie konsequent aus der Ich-Perspektive zu sprechen. Denn wie wir eine Situation erleben und deuten, ist immer subjektiv – und genau darin liegt der Wert echten Feedbacks.

In Gemeindeverwaltungen spielen Tugenden eine besondere Rolle
Denn hier treffen Bürgernähe, gesetzlicher Auftrag, politische Erwartungen und begrenzte Ressourcen aufeinander. Tugenden wie Verlässlichkeit oder Offenheit zeigen sich in der Praxis z. B. darin, dass eine Gemeindeverwaltung auf Anfragen von Bürger:innen verlässlich, transparent und respektvoll reagiert – auch dann, wenn es keine einfache Lösung gibt. Gerade in Zeiten knapper Ressourcen und hoher Erwartungen schafft ein solches Verhalten Vertrauen und signalisiert: Wir nehmen euch ernst und handeln verantwortungsvoll.
Ein tugendorientierter Ansatz beruht auf geteilter Verantwortung: Führungskräfte schaffen die Rahmenbedingungen, in dem sie ein respektvolles Miteinander sicherstellen, alle Mitarbeitenden sich offen äussern können und Fehler als Lernchancen verstehen, die nicht zu unverhältnismässigen Sanktionen führen. Gleichzeitig sind die Mitarbeitenden gefordert, aktiv zu einer wertschätzenden Zusammenarbeit beizutragen und die Bereitschaft zu haben, sich selbst zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Tugenden wie Offenheit, Demut, Freundlichkeit und Güte spielen dabei eine zentrale Rolle.
Fazit: Tugenden sind keine «weichen Faktoren» im Sinne unverbindlicher Nettigkeiten. Vielmehr bilden sie das tragfähige Fundament einer werteorientierten Verwaltungskultur — gerade dort, wo Fachkompetenz, Kommunikation und Haltung untrennbar miteinander verbunden sind.
Die Hochschule Luzern unterstützt Fach- und Führungspersonen dabei, solche werteorientierte Kompetenzen zu entwickeln — mit Weiterbildungen, Coaching-Angeboten und Projekten.
Autorin: Shiva Stucki-Sabeti



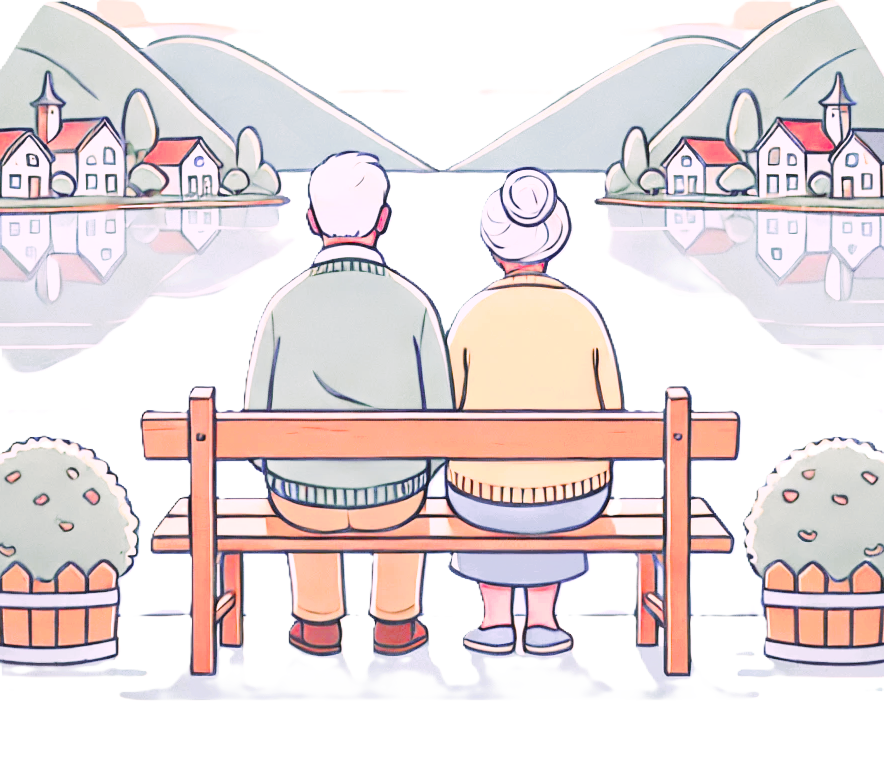
Kommentare
0 Kommentare
Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.