Gemeindeautonomie, quo vadis?
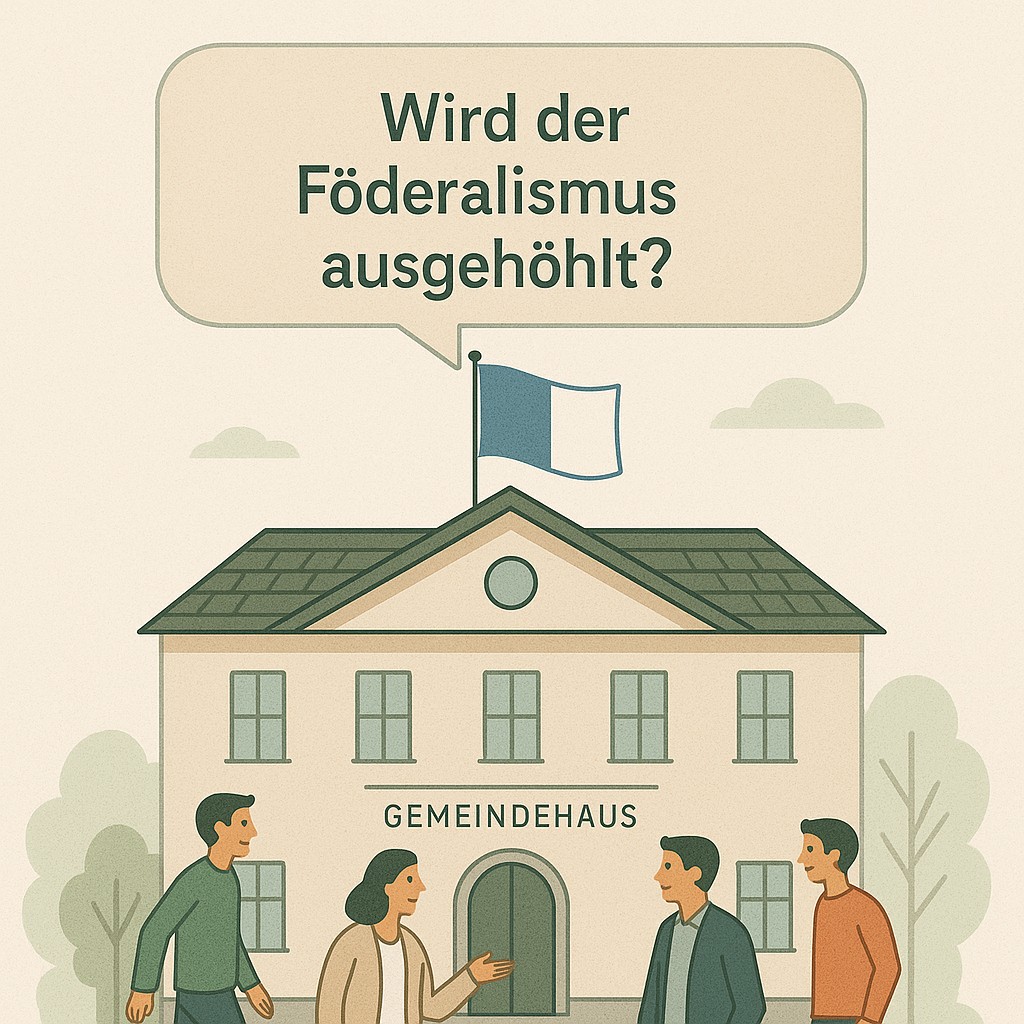
Das aktuelle Beispiel kommunaler Mindestlöhne
Am Dienstag hat der Kantonsrat Luzern entschieden, dass ein Gesetz ausgearbeitet werden soll, so dass kommunale Mindestlöhne künftig im Kanton Luzern verboten wären. Damit wäre die Stadt Luzern daran gehindert, den vom Stadtparlament beschlossenen Mindestlohn einzuführen. Dieser Entscheid wirft zentrale Fragen zur Gemeindeautonomie und zum Föderalismus in der Schweiz auf: Was dürfen Gemeinden eigentlich noch selbst entscheiden?
Was versteht man unter Gemeindeautonomie?
Die Gemeindeautonomie ist in der Bundesverfassung (Art. 50) verankert. Sie bedeutet, dass Gemeinden über ihre Angelegenheiten selbst bestimmen dürfen – allerdings «nach Massgabe des kantonalen Rechts». Mit anderen Worten: Der Kanton legt den Rahmen fest. Gemeinden haben Spielraum, solange Bund oder Kanton die Kompetenz nicht beanspruchen.
Dieses Zusammenspiel ist Ausdruck des Subsidiaritätsprinzips: Eine höhere staatliche Ebene soll nur dort eingreifen, wo die tiefere Ebene (z. B. die Gemeinde) eine Aufgabe nicht wirksam lösen kann. Allerdings ist das Subsidiaritätsprinzip rechtlich nicht einklagbar. Wenn also ein Kanton Aufgaben an sich zieht, müssen Gemeinden dies akzeptieren – auch wenn sie ihre Autonomie eingeschränkt sehen.

Mindestlöhne in der Stadt Luzern
Die Stadt Luzern hatte rechtmässig beschlossen, per 1. Januar 2026 einen kommunalen Mindestlohn einzuführen. Der Kantonsrat will das nun mit einer Gesetzesänderung verhindern. Bisher waren solche Regelungen auf Gemeindeebene zulässig, künftig sollen sie untersagt werden. Der Kanton greift damit direkt in einen demokratisch gefällten Entscheid der Stadt ein und beschneidet deren Gestaltungsfreiheit.
Dazu zwei abschliessende Gedanken:
- In der Debatte im Kantonsrat vermischten sich föderalistische Argumente (kein «Flickenteppich» an Mindestlöhnen) mit politischen Positionen (grundsätzliche Ablehnung von Mindestlöhnen). Während ersteres nachvollziehbar ist, wäre es ein problematisches Präjudiz, wenn Kantone künftig gezielt dort Kompetenzen an sich ziehen, wo Gemeinden politisch unliebsame Entscheide treffen. Das untergräbt das Subsidiaritätsprinzip.
- Auch wenn der einzelne Entscheid zu Mindestlöhnen nicht zentral für die Gemeindeautonomie sein mag: Er steht exemplarisch für eine Entwicklung, bei der Gemeinden schrittweise Entscheidungsfreiheit verlieren und vermehrt nur noch kantonale Vorgaben umsetzen. Das macht die Arbeit in Gemeinden (politisch und in der Verwaltung) nicht attraktiver.
Der Fall Luzern zeigt somit exemplarisch, wie kantonale Eingriffe die kommunale Selbstverwaltung schwächen können – eine Entwicklung, die längerfristig den Föderalismus aushöhlen kann.
Veröffentlicht am: 19. September 2025
Weiterführende Literatur zum Thema Gemeindeautonomie: Zustand und Entwicklung der Schweizer Gemeinden (Steiner et al. 2017)
Autor: Marco Eichenberger


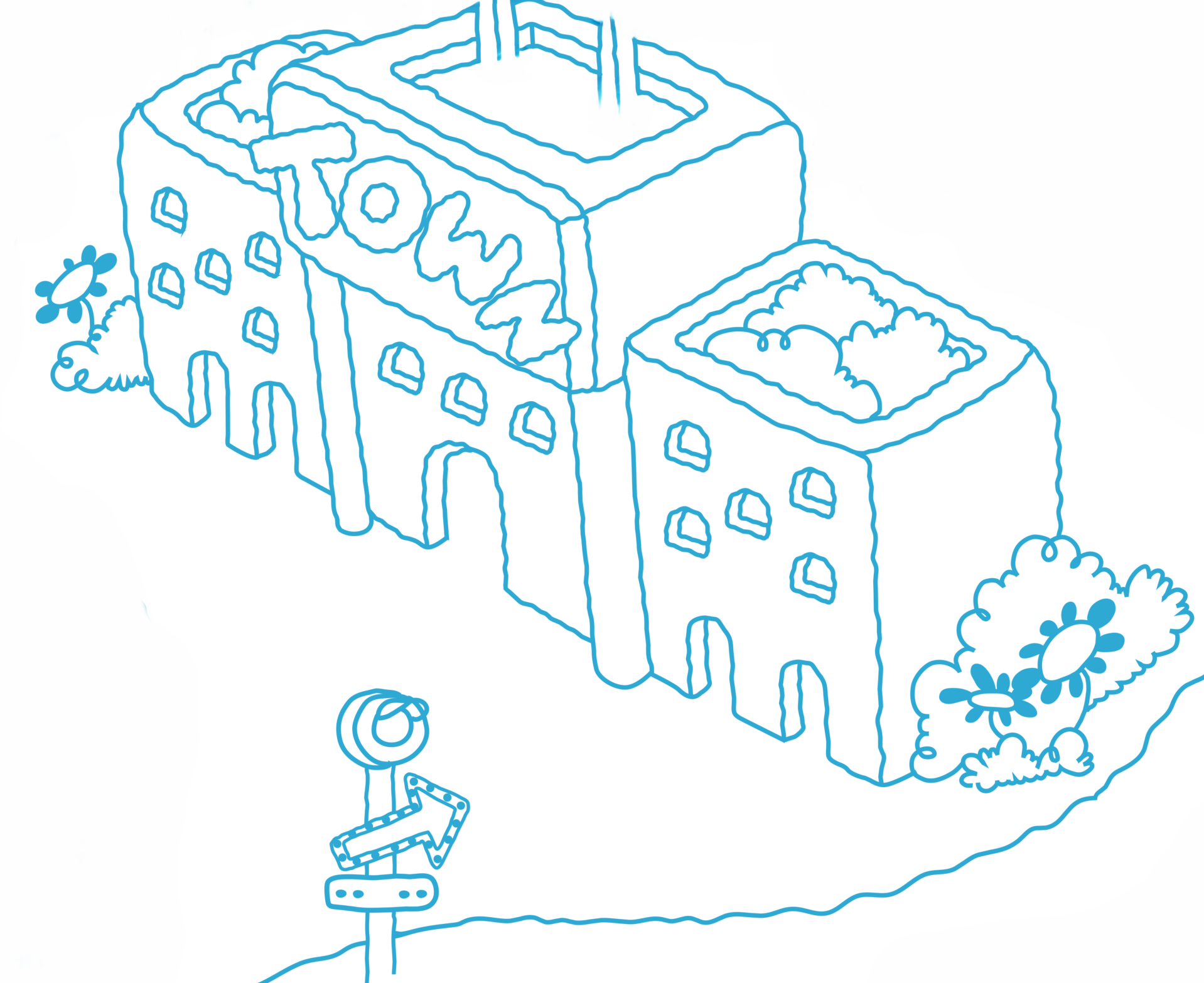
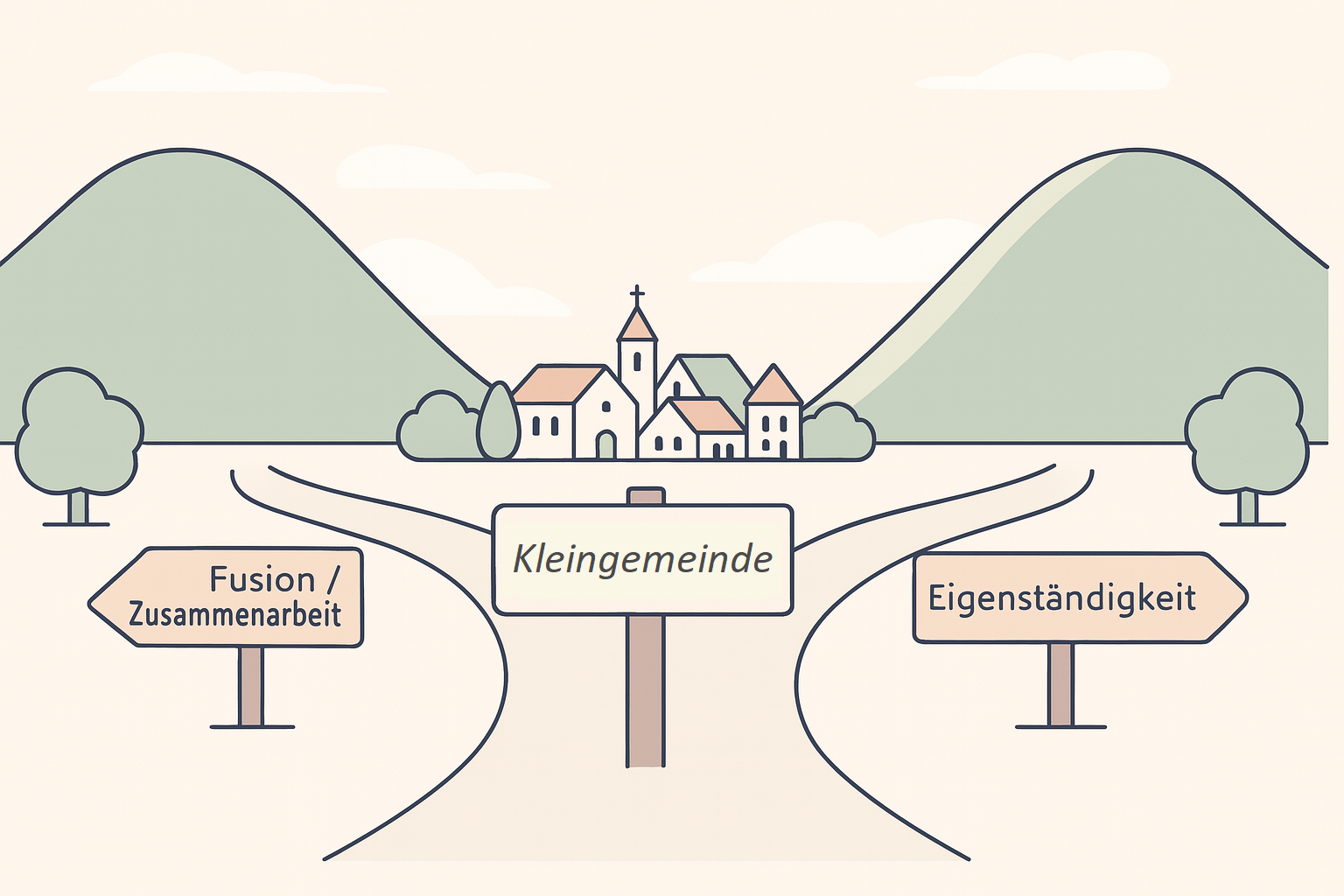
Kommentare
0 Kommentare
Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.