Kanton und Gemeinden im Clinch – was der Luzerner Schulstreit über den Föderalismus verrät

Im Kanton Luzern ist in diesen Wochen ein ungewöhnlich emotionaler Konflikt zwischen Kanton und Gemeinden entbrannt. Streitpunkt sind die sogenannten Pro-Kopf-Beiträge an die Raumkosten der Volksschulen: Ab 2026 will der Kanton diese Beiträge nach einem neuen Standardkostenmodell berechnen. Was nach einem technischen Detail der Finanzstatistik klingt, hat sich rasch zu einer politisch aufgeladenen Auseinandersetzung entwickelt.
Die Reform selbst ist sachlich kaum bestritten. Der Kantonsrat hatte die gesetzliche Grundlage für die Einführung von Standardkosten bereits früher beschlossen. Die neue Methode soll die Beiträge vereinheitlichen und transparenter machen: Anstelle empirisch ermittelter Durchschnittswerte gilt künftig ein einheitlicher Normbetrag pro Schülerin und Schüler. Damit lassen sich die Zahlungen einfacher berechnen und kantonsweit besser vergleichen.
Doch die Art und Weise, wie diese Umstellung erfolgt, sorgt für erhebliche Spannungen. Der Verband Luzerner Gemeinden (VLG) wirft dem Kanton vor, die Einführung zu abrupt und ohne ausreichende Konsultation der Gemeinden vollzogen zu haben. Der VLG spricht von einem Abbruch der „partnerschaftlichen Zusammenarbeit“ und prüft rechtliche Schritte. Der Kanton wiederum betont, die neue Methode sei im Gesetz vorgesehen und bringe langfristig mehr Fairness und Kostenklarheit.
Hier zeigt sich ein Muster, das für den schweizerischen Föderalismus typisch ist: Nicht die Verteilung der Kompetenzen selbst, sondern deren Ausübung und Abstimmung im Alltag führen zu Konflikten. Wenn eine Seite den Eindruck hat, übergangen oder zu spät einbezogen zu werden, wird das rasch als Verletzung der föderalen Partnerschaft empfunden – selbst dann, wenn der rechtliche Rahmen korrekt eingehalten wurde.

Der Luzerner Fall ist damit weniger ein Streit um Bildungspolitik oder Finanzen als um Vertrauen und Mitgestaltung. Der Kanton beansprucht Steuerung und Einheitlichkeit, die Gemeinden pochen auf Mitsprache auf Augenhöhe. Genau in diesem Spannungsfeld lebt der schweizerische Föderalismus.
Theoretisch lässt sich der Konflikt als Ausdruck einer „kooperativen Steuerungslogik“ deuten: In einem Mehrebenensystem wie dem schweizerischen Föderalismus können Entscheidungen nur wirksam werden, wenn sie nicht nur rechtlich legitim, sondern auch auf ein zweckgerichtetes Zusammenwirken abgestützt sind. In der Politikwissenschaft spricht man hier von Verhandlungssystemen, in denen Legitimität aus Zustimmung und Vertrauen entsteht. Genau dieses fragile Gleichgewicht zwischen Steuerung und Aushandlung steht im Luzerner Fall im Zentrum – und macht deutlich, dass föderale Politik nicht nur auf Strukturen, sondern auch auf Beziehungspflege angewiesen ist.
Was sich in den Luzerner Schulraumkosten zeigt, ist also nicht bloss ein Streit um Zahlen, sondern ein Beispiel für ein Grundproblem unseres politischen Systems: Föderalismus funktioniert nur dann gut, wenn neben den institutionellen Regeln auch die kooperative Beziehungsebene gepflegt wird.
Veröffentlicht am: 16. Oktober 2025
Weiterführende Literatur: Scharpf, Fritz W. (1988): Verhandlungssysteme, Verteilungskonflikte und Pathologien der politischen Steuerung, MPIfG Discussion Paper, No. 88/1, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln.
Autor: Nico van der Heiden

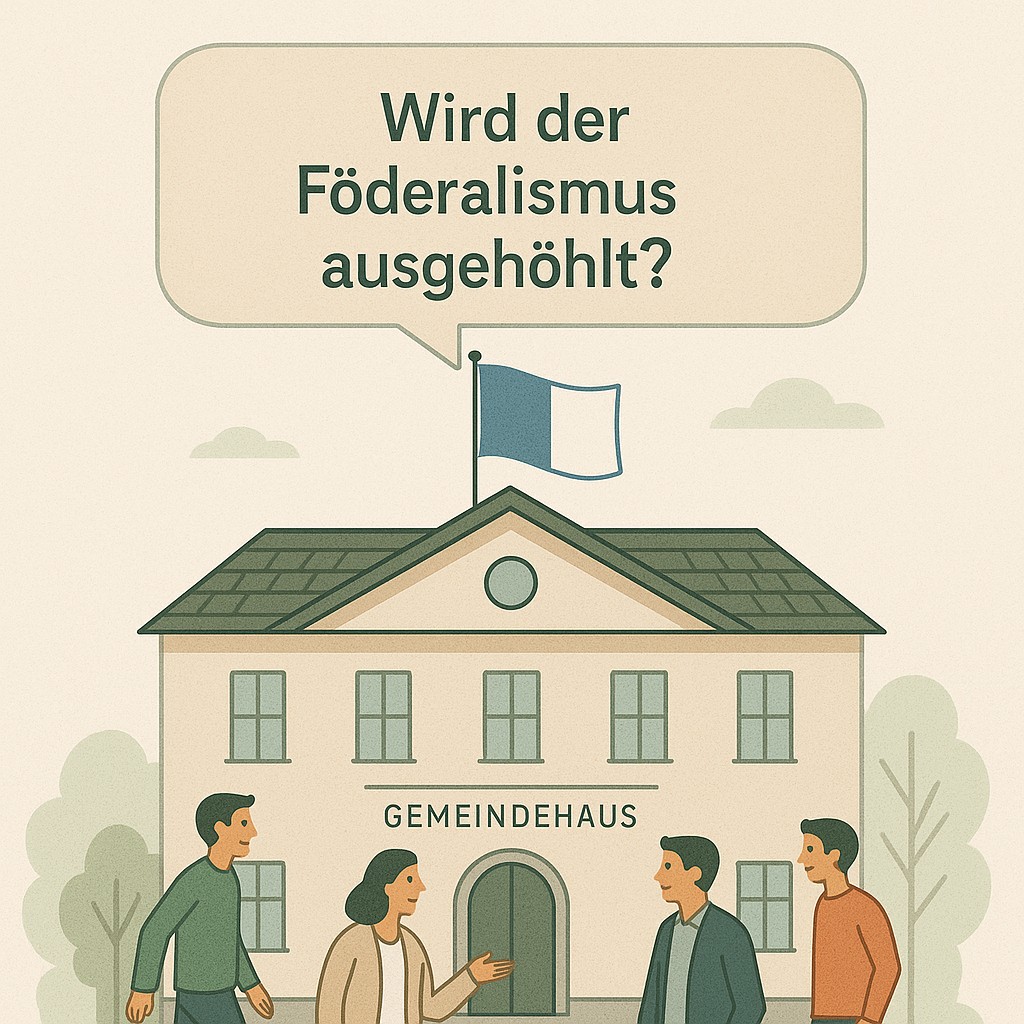
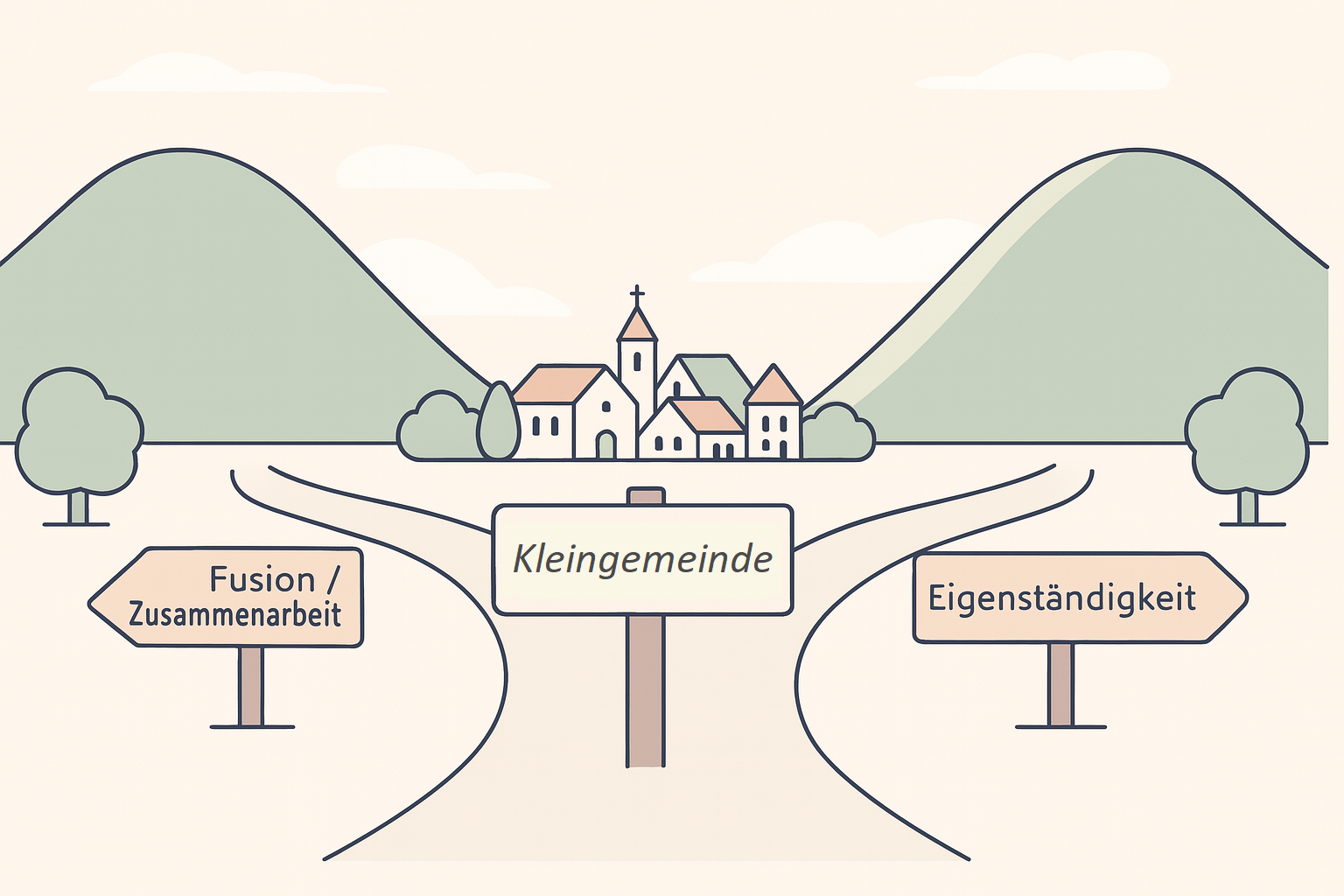

Kommentare
0 Kommentare
Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.