Wenn politische und operative Rollen verschmelzen – ein riskanter Balanceakt
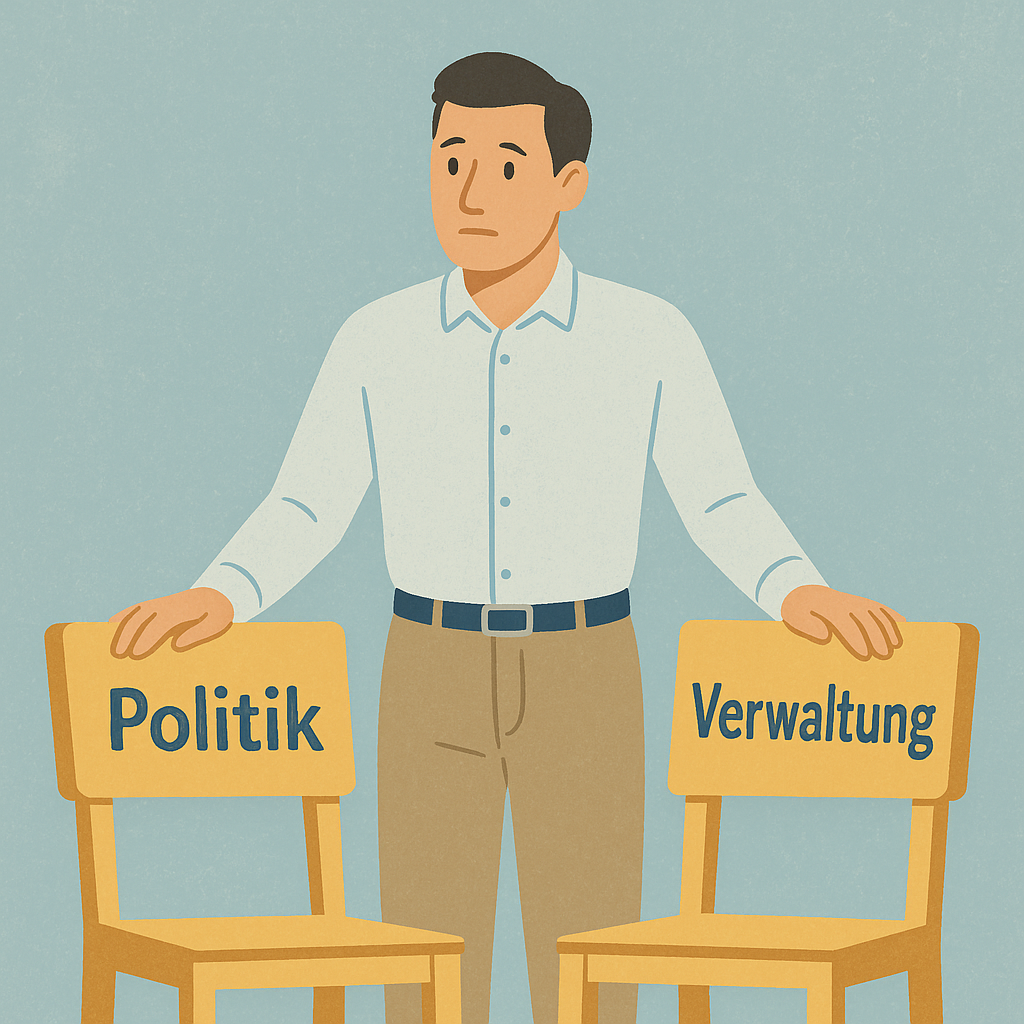
Was geschieht, wenn ein Gemeinderat gleichzeitig Geschäftsführer der eigenen Verwaltung wird? Ein aktuelles Beispiel aus dem Kanton Luzern zeigt, wie eng pragmatische Lösungen und Governance-Risiken beieinanderliegen.
Die Luzerner Gemeinde Altbüron kämpft mit einem Rekrutierungsproblem. Es lassen sich keine Kandidierenden für einen vakanten Gemeinderatssitz finden, die Geschäfte stapeln sich und der Wunsch nach flexiblerer und effizienterer Zusammenarbeit mit der Verwaltung ist gross. Nun greift die Gemeinde zu einem unkonventionellen Schritt und stellt den Gemeinderat Thomas Krauer (Mitte) zugleich als Geschäftsführer an, der die Verwaltung operativ leitet (Luzerner Zeitung vom 13.10.2025). Mit dieser Doppelrolle soll Effizienz geschaffen werden, wo Strukturen zu träge geworden sind.
Was pragmatisch klingt, ist aus Governance-Sicht heikel. Wenn ein gewähltes Exekutivmitglied gleichzeitig als operativer Geschäftsführer angestellt ist, verschmelzen zwei Ebenen, die strikt getrennt sein sollten: die strategische und die operative Führung. Der Gemeinderat beaufsichtigt sich somit faktisch selbst – eine institutionelle Schieflage mit Folgen für Transparenz und Kontrolle.
Was passiert beispielsweise, wenn Thomas Krauer bei den nächsten Wahlen nicht mehr gewählt wird? Dann endet das politische Mandat, doch das Anstellungsverhältnis als Geschäftsführer würde bestehen bleiben. Würde der Abgewählte in diesem Fall seine Anstellung künden oder weiterhin die Verwaltung leiten – nun aber im Auftrag eines neu zusammengesetzten Gemeinderats? Das Gedankenexperiment zeigt, wie hier die Grenzen zwischen politischer Legitimation und administrativer Verantwortung verwischen.
Auch im laufenden Betrieb führt das gewählte Führungsmodell von Altbüron zu einer problematischen Machtkonzentration. Eine Person, die politische Entscheide mitträgt und zugleich deren operative Umsetzung steuert, hält die Fäden an beiden Enden. Das mag kurzfristig effizient erscheinen, schwächt aber die kollektive Entscheidungsfähigkeit des Gemeinderats, schafft Abhängigkeiten und birgt das Risiko von Rollenkonflikten.

Zum Vergleich: Im Modell von Willisau, auf das sich Altbüron in seiner Mitteilung bezieht, wird der politisch gewählte Stadtammann in die Geschäftsleitung der Stadtverwaltung delegiert, jedoch nicht als Geschäftsführer angestellt. Als politischer Amtsträger sitzt er der Geschäftsleitung vor, wird aber von den operativ verantwortlichen Geschäftsleitungsmitgliedern – insbesondere auch vom Stadtschreiber – massgeblich bei der Führungsarbeit unterstützt.
Unsere Gemeindeforschung zeigt deutlich: Gemeinden mit klar getrennten Führungsrollen verfügen über stabilere Prozesse, höhere Zufriedenheit und mehr Vertrauen in ihre Entscheidungsstrukturen. Wo diese Trennung aufgegeben wird, drohen Steuerungsprobleme und institutionelle Spannungen. Für Altbüron zeichnen sich zwei Wege ab: Entweder tritt Thomas Krauer von seinem politischen Mandat zurück und übernimmt die Geschäftsführung in einer professionellen, administrativen Funktion. Oder er übernimmt die Rolle des Geschäftsführers ad interim, mit dem Ziel, die Gemeindeordnung anzupassen und mittelfristig ein Delegierten- oder Präsidial-Modell einzuführen. Auch diese Modelle sind von der Rollenteilung her nicht ideal, bieten aber eine klarere politische Abstützung und Legitimation.
Viele Gemeinden stehen heute unter Druck, Lösungen für ihre Milizproblematik zu finden. Doch der Weg in die Zukunft führt nicht über die Vermischung von Politik und Verwaltung, sondern über deren bewusste Abstimmung. Gute Gemeindeführung lebt von klaren Rollenverständnissen – und von der Einsicht, dass Professionalisierung nicht Verantwortungsbündelung, sondern Balance zwischen Entscheidungsträgern und Kontrollinstanzen bedeutet.
Lesetipp:
Schweizer Gemeinden kämpfen mit wachsender Komplexität ihrer Aufgaben und Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Exekutivmitgliedern. Dieses Handbuch analysiert die Führungsmodelle von über 600 Gemeinden in der Deutschschweiz und präsentiert innovative Anpassungsstrategien.
Veröffentlicht am: 23. Oktober 2025
Autor: Jonas Willisegger

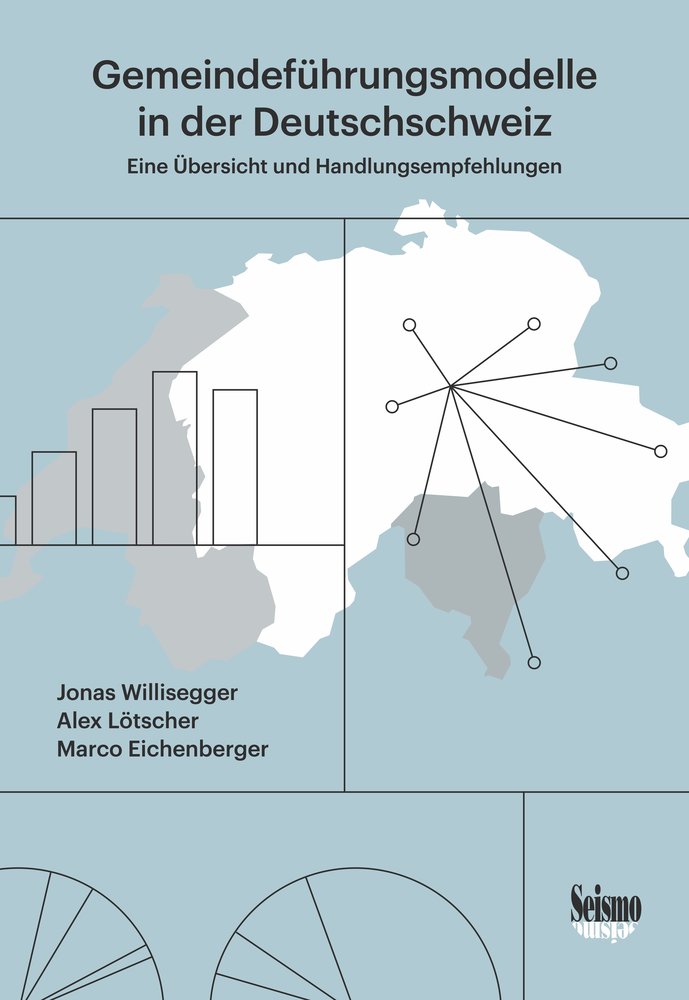

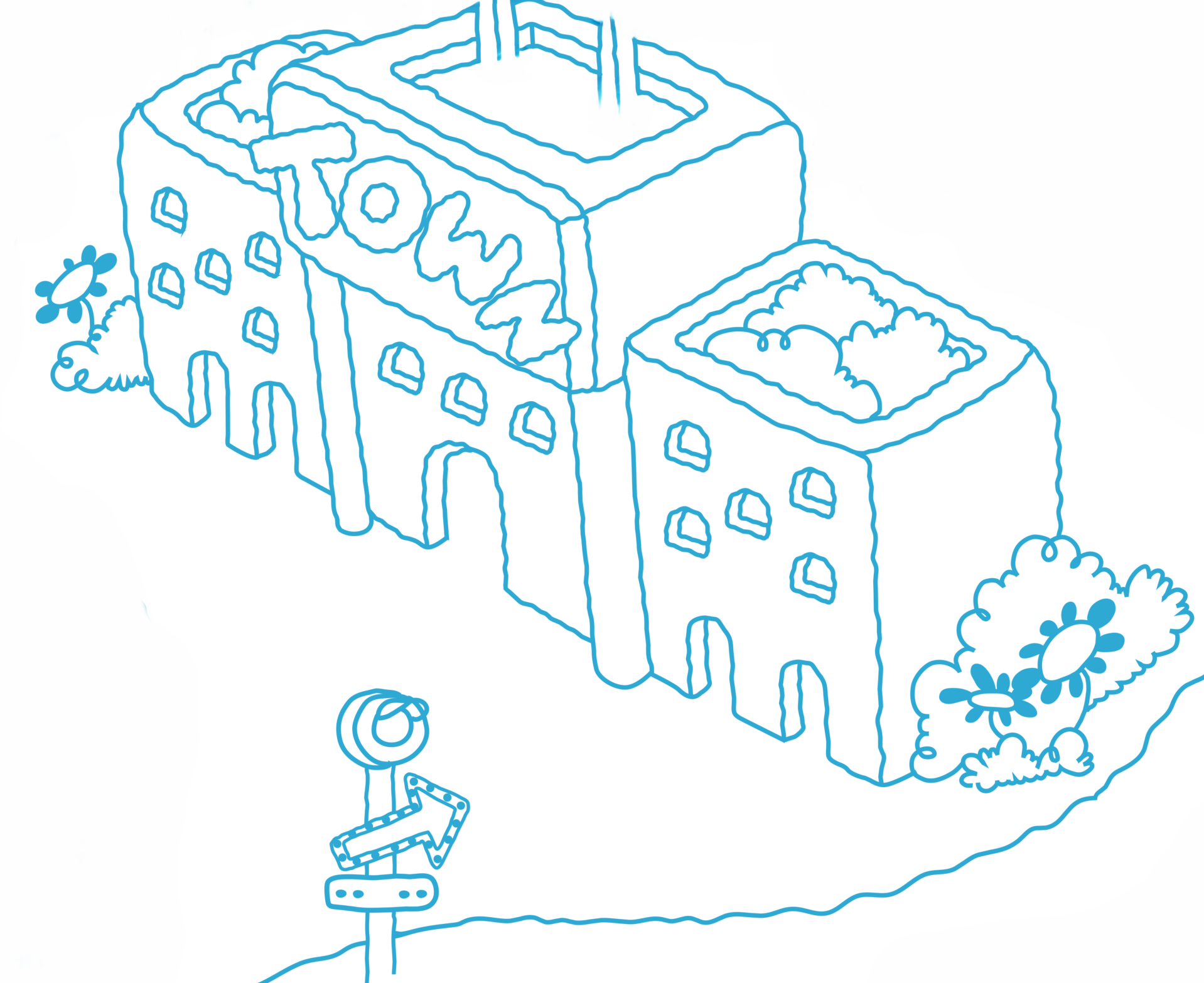
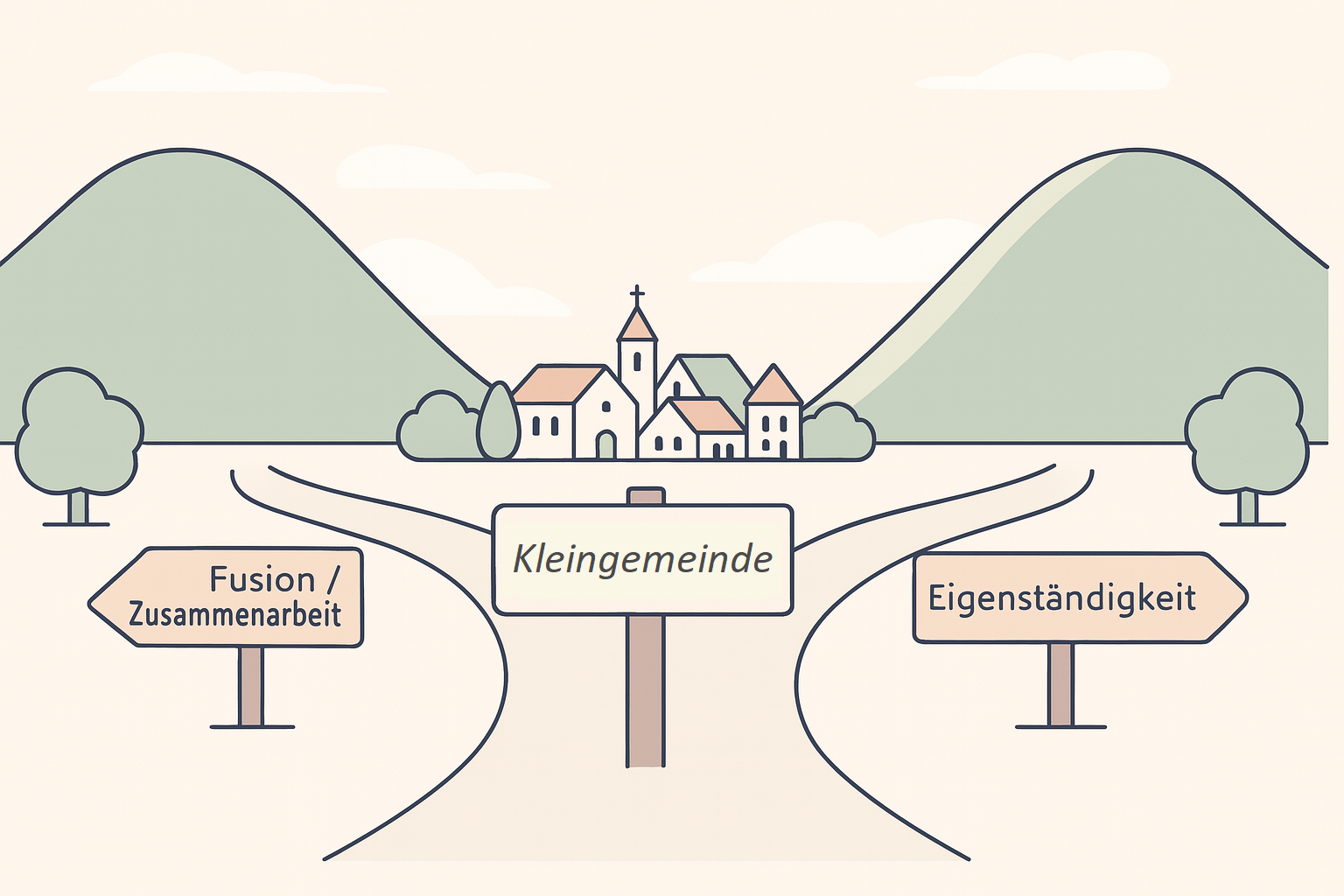
Kommentare
0 Kommentare
Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.