Dieter Ammann – ein eigenwilliger Komponist mit weit offenen Antennen

Der aus Zofingen stammende Komponist Dieter Ammann ist ein Phänomen. Früher spielte er als Musiker Free Funk, Rock und Jazz. Heute ist er der bedeutendste zeitgenössische Schweizer Komponist seiner Generation. Ammann, der an der Hochschule Luzern – Musik Komposition unterrichtet, erhielt für seine Werke zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen. Er hat mit renommierten Orchestern und Dirigenten gearbeitet, er war composer-in-residence am Lucerne Festival und sein Klavierkonzert «The Piano Concerto – Gran Toccata» wurde an den Proms in London uraufgeführt. Dennoch ist er der neugierige und sympathische Mensch geblieben, der eher wie ein cooler Rock’n’Roller wirkt denn wie ein distinguiert-elitärer Komponist. Aus Anlass seines 60. Geburtstages, der mit einer Konzert-Hommage im KKL Luzern gefeiert wird, haben wir ihn zum Interview getroffen.
Das Interview führte Pirmin Bossart
Dieter Ammann, es ist 18:45 Uhr, Sie kommen gerade von Ihrer letzten Lektion am heutigen Tag: Wie lange unterrichten Sie eigentlich schon Komposition an der Hochschule Luzern – Musik?
Seit über 30 Jahren. Damals allerdings Musiktheorie, denn es gab hier noch keine Möglichkeit, Komposition zu studieren. Heute gibt es den Master-Studiengang Komposition, man kann Komposition auch als Minor wählen oder im Bachelor als Schwerpunkt, selbst im Bereich Angewandte Theorie ist es möglich, eigene Musik zu kreieren. Und neu wird erstmals ein Bachelor in Komposition angeboten, die Anmeldungen sind schon zahlreich. Kurzum: Die Breite der Unterrichtseinheiten in Komposition an unserer Institution ist bemerkenswert. Viele Angebote finden im Einzelunterricht statt und können von allen Studierenden aller Profile (Klassik, Jazz, Volksmusik) besucht werden. Spannend ist auch die Klassenstunde, weil da oft verschiedene Profile zusammenkommen und wir Musik aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten und diskutieren.
Wie erleben Sie Ihre Rolle als Dozent? Was wollen Sie den Studierenden vermitteln?
Was mir gefällt ist die Möglichkeit, mich mit Musik auseinanderzusetzen, die nicht meine eigene ist, die künstlerischen Intentionen darin zu erspüren und zu schauen, wie diese umgesetzt werden. Ich bin nicht der Dozent, der den Studierenden irgendein System oder gar meine persönliche musikalische Welt aufoktroyieren will. Ich versuche zu hören und zu erspüren, wohin jemand sich entwickeln könnte, egal in welchen stilistischen Gefilden sich das abspielt. Das setzt natürlich voraus, dass man über die verschiedenen Stile und Ästhetiken Bescheid weiss und auch deren Qualitätsmerkmale kennt.
Das ist bei Ihnen ja die Besonderheit, dieser vielfältige Background. Sie haben als Musiker mit Jazz, Rock und Funk begonnen, heute sind Sie ein international renommierter Komponist für zeitgenössische Musik.
Es hat schon früher begonnen: Mein Vater war ein ausgezeichneter Stegreif-Klavierspieler. Er wollte Pianist werden, durfte dies aber nicht. Er hat dann sein naturwissenschaftliches Studium mit Tanzmusik verdient. Mein Vater hat mit mir und meinem Bruder von klein auf immer Musik gemacht. Wir hatten oft Besuch zuhause und da durften wir vorspielen, immer ohne Noten. Bis heute komme ich nicht von der Notation, sondern vom Gehör her.
Das innere Ohr zu entwickeln ist eine Lebensaufgabe.
Dieter Ammann
Das sagen Sie als Komponist, der die Musik ja auch notieren muss.
Aber zuerst muss er sie hören können. Das innere Ohr zu entwickeln ist eine Lebensaufgabe. Den Rest habe ich nach und nach gelernt. Ich war in meinen Studienzeiten immer ein wenig stolz und auch froh, in der Gehörbildung mit der raschen Niederschrift eines vierstimmigen Bach-Chorals keine Mühe zu haben. Ein gutes Gehör hilft auch im Kompositionsunterricht, etwa um ein erstes, fundiertes Feedback zu geben und die Klangqualitäten zu erkennen. Es gilt ja, auf die Musik reagieren zu können, mit der die Studierenden zu einem kommen. Partiturlesen ist für mich jedoch manchmal auch heute noch eine Art Umweg.
Sie haben nach Schulmusik in Luzern und Jazz in Bern auch Theorie/Komposition in Basel studiert. Was hat Ihnen bei diesem Studium am meisten geholfen?
Ich war ein ziemlicher Exot in Basel, da ich nicht aus dem typischen klassischen Umfeld kam. In Luzern hatte ich zwar eine exzellente Ausbildung in Musiktheorie erhalten, aber als Musiker habe ich mich nicht im klassischen Umfeld bewegt. Ich spielte Jazz, Rock, Funk und Punk, etwa mit Donkey Kong’s Multi Scream oder mit Steven’s Nude Club, daneben auch frei improvisierte Musik oder, um Geld zu verdienen, auch Tanzmusik. Im Dozenten Roland Moser fand ich zum Glück einen sehr offenen Geist. Das half, dass ich mich im Basler Hochschulbetrieb heimisch zu fühlen begann. Ich habe damals übrigens noch kaum komponiert, sondern vor allem Musiktheorie studiert.


Was hat Sie eigentlich in die musikalische Welt der zeitgenössischen Musik geführt? Gab es da prägende Hörerlebnisse, Begegnungen, Entdeckungen?
So genau kann ich das nicht sagen. Ich erinnere mich jedenfalls nicht an ein Initiationserlebnis, vielmehr war es ein langsames Kennenlernen. Wichtig waren sicherlich die Dozenten, die einem etwas nahebringen konnten. Und wahrscheinlich spielte dieselbe Neugier mit, die mich schon früher antrieb, nicht nur Standards oder cleanen Jazzrock zu spielen, sondern anderes auszuprobieren. Wir haben ja immer gesucht – und oft auch gefunden.
Können Sie zwei drei Ereignisse nennen, die für Sie zu den Höhepunkten Ihres musikalischen Schaffens gehören?
Dazu gehört sicher mein Einstieg ins Komponieren: 1991 schrieb ich für das ensemble für neue musik zürich meine erste Auftragskomposition. Hochprofessionelle Musiker befassten sich mit dem, was ich geschrieben hatte. Das gab mir mein erstes Gefühl, ein Komponist zu sein. Faszinierend war drei Jahre später meine erste Orchestererfahrung. Es war ein Stück für Saxofon und Orchester, das vom Luzerner Sinfonieorchester uraufgeführt wurde. In der ersten Orchesterprobe konnte ich hautnah hören, was ich mir innerlich vorgestellt hatte. Das gab mir einen veritablen Glückshormonschub. Ich spürte, dass die Musik Hand und Fuss hatte. Ein Highlight par excellence war natürlich später die Zusammenarbeit mit Pierre Boulez.
Erzählen Sie.
Bei der ersten Begegnung im Rahmen des Lucerne Festivals haben drei Mitglieder der Berliner Philharmoniker Pierre Boulez und seiner Entourage mein Streichtrio vorgespielt. Nach dem Vortrag war Totenstille. Dann sagte Boulez: Oft klingt die Musik, die mir vorgesetzt wird, ähnlich wie meine eigene. Aber das hier ist wirklich eine eigene, ausserordentliche Musik. Das war ein Erlebnis: Auf dem Prüfstand zu stehen vor jemanden, der das 20. Jahrhundert musikalisch massgeblich mitgeprägt hat. Ich war natürlich sehr glücklich über seine positive Reaktion. Jahre später war ich dann composer-in-residence am Lucerne Festival. Dort hat er mein sinfonisches Triptychon mit den drei Werken «Core – Turn – Boost» uraufgeführt. Das Mittelstück «Turn» hatte ich als Auftrag von Lucerne Festival speziell für diese Aufführung geschrieben.
Auf was in Ihrer Karriere sind Sie stolz, was war besonders einmalig?
Die Uraufführung meines Klavierkonzerts «The Piano Concerto (Gran Toccata)» mit dem Solisten Andreas Haefliger an den Londoner Proms in der Royal Albert Hall war etwas ganz Einmaliges. Sie erfolgte am gleichen Abend, an der Beethovens Neunte Sinfonie gespielt wurde. Und diese wird immer gespielt. Das ist der Traditionsanlass an den Proms. Etwa 8000 Leute waren da, es herrschte eine extreme Konzentration im Publikum. Am Schluss war klar: Da ist etwas angekommen. Und danach war da die internationale Resonanz. Es erschienen weltweit unzählige Kritiken. Zum Glück war meine Frau Yolanda und zwei meiner Söhne mit dabei. Mit ihr fühle ich mich an solchen Anlässen immer sicherer und stärker.


Die «Gran Toccata» ist für das Orchester und vor allem für den Pianisten eine enorme Herausforderung.
Absolut. Haefliger spielt das Werk fantastisch. Ich könnte das selber nicht. Meine Musik ist zwar für die Interpreten eine echte Herausforderung, aber ich schreibe für alle Instrumente immer Dinge, die ich mit meinem inneren Ohr und von der erforderten Physis her vollumfänglich begreifen kann. Es geht nie um eine spekulative Virtuosität.
Wie erleben Sie den Prozess des Komponierens? Was stösst ihn an?
Ich muss zu Beginn den Klang in Bewegung setzen, mit einer Geste oder einer grösseren Gestalt, dann beginne ich einen Faden zu entwickeln. Meine hohen Ansprüche, und damit verbunden auch Selbstzweifel, lassen mich jeweils nur sehr langsam vorankommen. Meine Arbeitsgeräte sind Partiturbögen, Bleistifte und Geodreieck. Bei Orchesterwerken kann ich daher nicht auf dem Computer eben mal nachhören, wie es klingt, was ich notiert habe. Sich Musik für sechzig, siebzig Musikerinnen vorzustellen ist nicht so einfach, das weiss auch jeder Dirigent. Sie zu komponieren, also eine Klanglichkeit zu erschaffen, die es so noch nicht gibt, ist wirklich schwierig. Es ist ein eigentliches «componere», also zusammensetzen. Dabei ist die Klangfarbe immer ein integraler Bestandteil der Idee. Ich könnte nicht Musik schreiben und sie nachträglich instrumentieren. Die Farben habe ich beim Komponieren immer im Ohr und weiss auch, wie komplett unterschiedlich die verschiedenen Instrumente funktionieren. Man sagt meiner Musik nach, dass sie zwar sehr komplex sei, aber gleichzeitig ein beinahe körperliches Hörerlebnis ermögliche. Ich denke, dass der Klangfarbenreichtum – nebst dem ausgeprägten Sinn für Rhythmik und sorgfältig austarierte harmonische Vorgänge – eines meiner wichtigsten kompositorischen Elemente ist.
Hat sich Ihr Schreiben verändert, wie sehen Sie das?
In meinen neueren Stücken zeigt sich ein unverkrampfteres Verhältnis zu früherer Musik. Das Tonale bekommt mehr Gewicht, ich arbeite stärker mit Konsonanz- und Dissonanz-Verhältnissen. Ich gehe aber auch in die Mikrotonalität hinein und raffinierte Klangmischungen sind wohl zeitlebens ein wichtiges kompositorisches Thema. Meine Palette an Ausdrucksmitteln ist sehr breit. Warum soll ich etwas ausgrenzen, nur weil es im musikhistorischen Kontext schon da war? Es geht weniger um die Mittel, das Material, als vielmehr darum, etwas Eigenständiges damit aussagen zu können. Alles Korrekte im Sinne der Neuen Musik ist oft auch korrekt langweilig. Es braucht aber sogar heute noch etwas Mut, Tonalität im weitesten Sinn zu integrieren, da sie einem teilweise richtiggehend ausgetrieben wurde.
Inwieweit hat die Digitalisierung Ihre Arbeit und die Komposition beeinflusst?
Auf mich als Komponist hat sie keinen Einfluss, da ich wie erwähnt meine Partituren mit dem Bleistift schreibe. Im Unterricht hat das Digitale spätestens seit der Pandemie einen viel grösseren Stellenwert bekommen. Der Homeoffice-Betrieb funktionierte im Fach Komposition erstaunlich gut. Man guckt einfach auf den eigenen Bildschirm statt auf den Bildschirm der Studierenden, das lässt sich gut bewerkstelligen. Ich habe jedenfalls nicht festgestellt, dass Studierende wegen des Onlineunterrichts weniger kreativ geworden wären oder weniger geleistet hätten.
Was sind für Sie drei kompositorische Werke in der Musikwelt, die Sie nicht missen möchten und die für Sie über Jahre hinweg beispielhaft geblieben sind?
Ich würde diese Frage lieber etwas genereller beantworten. Im Jazz möchte ich den Be Bop nicht missen, da ich diese Mischung aus instrumentaltechnischer Fertigkeit und treibendem Interplay bei oft hohen Tempi sehr mag. Im populären Bereich kommt mir an erster Stelle Prince in den Sinn. Es ist einmalig, wie er die verschiedensten musikalischen Einflüsse zusammenführen oder sie auch nebeneinander stehenlassen konnte. Bei den Komponisten denke ich etwa an Ligeti oder Witold Lutosławski, die beide Türöffner für mich waren. Bei Lutosławski bewundere ich, dass seine strukturell so straff organisierte Musik trotzdem so sinnlich ist. Ligeti war immer sehr eigenständig und erst noch ein auraler Visionär, etwa was seine Klangflächenkompositionen anbelangt. Auch seine oft klare Rhythmik, spürbare Pulsationen und Tempi holen einen als Hörer ab. Geht man etwas zurück kommen mir Namen wie Ravel und Prokofjew, Bartók oder Strawinsky in den Sinn, bei ersteren vor allem die Klavierkonzerte, bei Bartók etwa die Streichquartette und bei Strawinsky vor allem seine sogenannt folkloristische Phase, etwa die unglaubliche Wucht eines «Sacre du printemps», wo ebenso die rhythmische Komponente weit mehr war als ein Gerüst für Tonhöhenverläufe. Aber es gibt viel Musik, die mich interessiert und auch inspiriert. Dazu gehört auch der wertvolle Austausch mit Komponistenkollegen, etwa Wolfgang Rihm oder George Benjamin. Musik ist Lebensinhalt, deren Reichtum nie versiegt.

Bilder: Privatarchiv Dieter Ammann
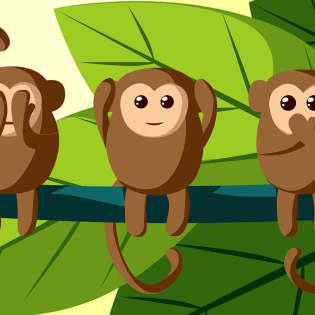



Kommentar verfassen
Dein Kommentar wurde gesendet, er wird nach der Überprüfung veröffentlicht.