Arbeits- & Organisationspsychologie,
Back to the Future: Wie wir „New Work“ sinnhaft und gesundheitsorientiert gestalten

Lesezeit 7′ min // Blogbeitrag zum Kapitel: «New Work» und Gesundheit, verfasst von Ferdinand Baierer und Prof. Dr. Jürgen Glaser
Die Arbeitswelt befindet sich im stetigen Wandel: Mechanisierung, Massenproduktion, Computer und Automatisierung sowie Cyber-Physical Systems haben die Bedingungen der Erwerbsarbeit verändert und verändern sie weiterhin. Doch welche Chancen und Risiken gehen mit der durch die Digitalisierung ermöglichten, flexiblen und zunehmend entgrenzten Arbeit einher und wie kann diese „New Work“ gesundheitsförderlich gestaltet werden?
Herausforderungen der digitalisierten Arbeitswelt
Der digitale Wandel bringt neue Anforderungen für Mitarbeitende und Organisationen mit sich. Durch die technologische Beschleunigung der modernen Gesellschaft lässt sich eine Intensivierung der Arbeit beobachten, das heißt eine Verdichtung der Arbeitsaufgaben in der verfügbaren Arbeitszeit. Bereits seit den 1990er Jahren berichten Erwerbstätige von zunehmender zeitlicher Überforderung und engeren Deadlines. Zudem verlangen die Arbeitstätigkeiten immer komplexere Fähigkeiten zur Aufgabenerledigung bei höherer wechselseitiger Abhängigkeit und gestiegenen Kooperationsanforderungen in einer globalisierten Welt. Mit dem Einzug leistungsfähiger Computer, der flächendeckenden Einführung von Netzwerken und insbesondere dem Siegeszug von Internet, Laptop und Smartphone, stieg auch die Möglichkeit der Extensivierung der Arbeit. Erwerbstätige berichten von zunehmendem Druck unerledigte Arbeitsaufgaben zeitlich und örtlich entgrenzt zu erledigen. So können bereits auf dem Weg zur Arbeit erste E-Mails beantwortet werden, um die Arbeitslast am Tag zu reduzieren. Während der Mittagspause können Besprechungen stattfinden, um während der Arbeitszeit Raum für andere Aufgaben zu schaffen. Abends können die letzten Arbeitsschritte abgeschlossen werden, sodass am nächsten Tag genügend Zeit für andere Aufgaben zur Verfügung steht. Inzwischen gewinnt diese unkompensierte betriebliche Mehrarbeit aufgrund der damit einhergehenden Erholungsverluste und gesundheitlichen Risiken auch zunehmend an politischem Interesse. Während Gewerkschaften verbindliche Regelungen zur Begrenzung ständiger Erreichbarkeit und unbezahlter betrieblicher Mehrarbeit fordern, setzen sich Arbeitgeberverbände für den Erhalt unternehmerischer Flexibilität durch eine vertrauensbasierte Arbeitszeitgestaltung statt einer verpflichtenden Erfassung ein. Doch wie lassen sich diese vielfältigen Ansprüche an „New Work“ miteinander vereinbaren?
„New Work“ ist nicht gleich New Work
Ursprünglich prägte der Philosoph und Anthropologe Frithjof Bergmann den Begriff New Work als kapitalismuskritischen Ansatz. In seiner New-Work-Zukunftsutopie wird Lohnarbeit hinfällig, da alle Güter, die zum Leben notwendig sind, durch technologische Entwicklungen in Eigenarbeit oder in kleinen nachbarschaftlichen Netzwerken hergestellt werden können. Menschen arbeiten, geleitet von ihren wirklichen Bedürfnissen und Talenten, selbstbestimmt an dem, was sie wirklich interessiert, und können so ihre Potenziale verwirklichen.
Heute versteht man in der betrieblichen Praxis unter dem Begriff „New Work“ vor allem zeitlich und örtlich flexible Arbeitsformen, die durch die technologische Entwicklung möglich und durch die technologische Beschleunigung in der Gesellschaft teilweise notwendig geworden sind. Typische Beispiele sind die Möglichkeiten für Homeoffice dank online zugänglicher Datenbanken oder Desksharing im Büro durch ortsungebundene Arbeitsmittel wie Laptops und Smartphones. Diese Entwicklungen begünstigen auch zeitliche Flexibilisierungsmöglichkeiten. Mithilfe von VPN-Zugängen, Cloud-Diensten und mobilen Endgeräten können Beschäftigte jederzeit auf betriebliche Software zugreifen und Arbeitsaufgaben auch außerhalb klassischer Bürozeiten erledigen. Dadurch entstehen zeitliche Freiheitsgrade für flexible Gleitzeitmodelle: Mitarbeitende können Arbeitspakete zu Uhrzeiten abarbeiten, die besser zu ihrem Privatleben passen, und sind nicht mehr gezwungen, im 9-to-5-Rhythmus zu arbeiten. Zweifelsohne haben Berufsgruppen mit hohen Anteilen an informationsbezogenen Tätigkeiten ein höheres Potenzial flexibel zu arbeiten, jedoch können auch die Tätigkeiten einer ambulanten Pflegekraft beispielsweise durch telemedizinische Systeme unterstützt, oder Arbeiten in der Produktion durch modulare Dienstpläne und neuen Arbeitsformen wie Job-Sharing zeitlich flexibler gestaltet werden.
Die „Neue Arbeit“ durchläuft demnach einen formellen und strukturellen Wandel, der die Art und Weise, wie gearbeitet wird, verändert. Die Nutzung – und zunehmend auch die Abhängigkeit – von digitalen Technologien zur erfolgreichen Bewältigung von Aufgaben prägt das Arbeitsbild ebenso wie die Flexibilisierung von Arbeitsvertrag, -ort und -zeit. Diese Flexibilisierung kann jedoch auch eine Entgrenzung mit sich bringen, bei der „Trennwände“ zwischen Lebensdomänen durchlässig werden oder ganz verschwinden. Auch die Haltung zur Arbeit wandelt sich: Weg von Fremdbestimmung, hin zu stärkerer aktiver Partizipation an Unternehmensentscheidungen. Weg von entfremdeter Arbeit ohne Gestaltungsspielräume, in der Arbeitende nur passiver Teil des mechanischen Ablaufs sind, hin zu sinnhaften und bedeutungsvollen Arbeitstätigkeiten, bei denen Menschen aktiv das Arbeitssystem mitgestalten.
Autonomie als zentraler Faktor von gesundheitsförderlicher „New Work“
Im Arbeitskontext beschreibt Autonomie die persönliche Kontrolle über die Inhalte und Abläufe der Arbeitsaufgaben. Sie gilt als eine der wichtigsten arbeitsbedingten Ressourcen für Erwerbstätige. Dies zeigt sich auch im Kontext von „New Work“. So hat beispielsweise die Verfügbarkeit von Flexibilisierungsoptionen einen stärkeren Einfluss auf die Gesundheit als deren tatsächliche Nutzung. Eine Verpflichtung zur Nutzung zeitlich und ortsflexibler Arbeitsoptionen durch Betriebe kann sich hingegen sogar negativ auf die psychische und körperliche Gesundheit auswirken. Dies lässt sich damit erklären, dass Mitarbeitende ihre persönlichen und zeitlichen Ressourcen effizienter nutzen können, wenn sie einen höheren Anteil an eigener Kontrolle bzw. Autonomie über die zeitliche und örtliche Erledigung ihrer Arbeitsaufgaben haben.
Solche Freiheitsgrade können jedoch auch negative gesundheitliche Konsequenzen haben, wenn die Arbeitstätigkeiten nicht aus persönlichen Werten oder eigenem Interesse heraus geleitet werden, sondern fremdbestimmt sind. Besonders entgrenzte Formen der Arbeit wie betriebliche Mehrarbeit werden durch externen Druck motiviert, beispielsweise durch Arbeitsüberlastung oder (implizite) Erreichbarkeitserwartungen von Kolleg:innen oder Vorgesetzten. Betriebliche Mehrarbeit sollte demnach nicht als eine Erweiterung der persönlichen Kontrolle über die Arbeitserledigung verstanden werden, die zu höherer Gesundheit führt, sondern als fremdbestimmte Verpflichtung zur unkompensierten Verlängerung der Arbeitszeit, wodurch Ruhezeiten verkürzt oder unterbrochen werden. Auch augenscheinlich positive Flexibilisierungsmöglichkeiten können mit negativen Konsequenzen einhergehen, wenn diese unzureichend gestaltet werden. So muss beispielsweise bei Vertrauensarbeitszeit die zeitliche Lage der Arbeits- und Erholungszeiten oft nach eigenem Empfinden selbst gestaltet werden. Bei anhaltend hoher Arbeitsbelastung durch die zunehmende Arbeitsintensivierung besteht das Risiko, dass Pausen- und Erholungszeiten nicht optimal gestaltet werden. Dadurch werden die für die Wiedergewinnung von verbrauchten Ressourcen notwendigen Erholungsprozesse gestört und die Gesundheit wird beeinträchtigt.
Bei der Einführung von Konzepten zu „New Work“ sollte deshalb die Autonomie über Arbeitsabläufe und Nutzung von Flexibilisierungsoptionen eine maßgebliche Rolle spielen, speziell die persönliche Kontrolle über Zeit und Ort. Demnach sollten Mitarbeitende selbst entscheiden können, wie und wann sie Möglichkeiten der Flexibilisierung einsetzen, die vom Betrieb zur Verfügung gestellt werden.
Nachhaltige „Neue Arbeit“ braucht Arbeits- und Organisationspsychologie
„New Work“ ist kein Patentrezept, kein „One Size Fits All“ das in jedem Kontext gleichermaßen funktioniert. Vielmehr sind arbeitswissenschaftlich optimierte, betriebs-, arbeitsgruppen- und individualspezifische Konzepte für eine angemessene Gestaltung der „Neuen Arbeit“ notwendig. Der aktuelle Trend um „New Work“ verleitet manche Unternehmen dazu, Instrumente wie Telearbeit, flexible Bürokonzepte wie Desksharing oder flexibel-entgrenzte Arbeitszeiten vorschnell einzuführen – häufig mit dem Ziel, im umkämpften Arbeitnehmermarkt attraktiv zu wirken. Doch wer diese Instrumente nur implementiert, um Teil eines Trends zu sein, läuft Gefahr an der eigentlichen Zielsetzung vorbeizuarbeiten. Denn New Work ist mehr als eine Ansammlung flexibler Tools – es beruht auf einer humanorientierten Grundidee, die die Bedürfnisse und Potenziale der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Statt kurzfristiger Symbolpolitik braucht es eine reflektierte Umsetzung, die die zentralen psychologischen Bedürfnisse ernst nimmt:
- Sinn in der Arbeit erleben,
- Autonomie, also die Möglichkeit, Arbeitsweise, -ort und -zeit im eigenen Rahmen selbst zu gestalten,
- Kompetenzerleben durch bewältigbare und lernförderliche Arbeitsaufgaben, sowie
- soziale Eingebundenheit im Team und in der Organisation.
Nur wenn New-Work-Maßnahmen auf diese Bedürfnisse abgestimmt sind, können Unternehmen wirtschaftliche und humanorientiert nachhaltige Arbeit sichern und den Herausforderungen der digitalisierten Arbeitswelt souverän begegnen.
Mehr zu dem Thema erfahren?
Wer mehr über die Zukunft der Arbeit erfahren möchte, findet ausführliche Informationen im Kapitel 8:
«New Work und Gesundheit» von Prof. Dr. Jürgen Glaser und Ferdinand Baierer
Link zum Buch auf Springer
Referenzen
Foto von StockSnap: https://pixabay.com/photos/computer-keyboard-apple-electronics-2565478/

Informationen zum Autor
Ferdinand Baierer
Ferdinand Baierer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent am Institut für Psychologie der Universität Innsbruck. Er ist Mitglied des Vorstands der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie und als freiberuflicher Berater für die arbeitspsychologische Unternehmensberatung Humane Arbeit GmbH tätig. In seiner Forschung rund um das Thema gesundheitsförderliche Arbeit beschäftig er sich mit den Schwerpunkten Selbstdetermination, psychischer Stress, Erholung sowie Flexibilisierung und Entgrenzung von Arbeit.

Informationen zum Autor
Prof. Dr. Jürgen Glaser
Jürgen Glaser ist Professor für Angewandte Psychologie mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Innsbruck. Er leitete von 2017 bis 2021 das Institut für Psychologie der Universität Innsbruck und ist Gründungsmitglied der arbeitspsychologischen Unternehmensberatung Humane Arbeit GmbH. Jürgen Glaser leitete zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Auftrag von Bundes- und Landesministerien in Deutschland und Arbeiterkammern in Österreich zu Themen rund um Arbeit und Gesundheit. Er entwickelte Verfahren zur psychologischen Analyse von Arbeitsprozessen und forscht zu den Schwerpunkten Analyse und Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeit, psychischer Stress und Burnout, Interaktions- und Emotionsarbeit in der Humandienstleistung, Führung und Gesundheit sowie Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung in und jenseits der Erwerbsarbeit.

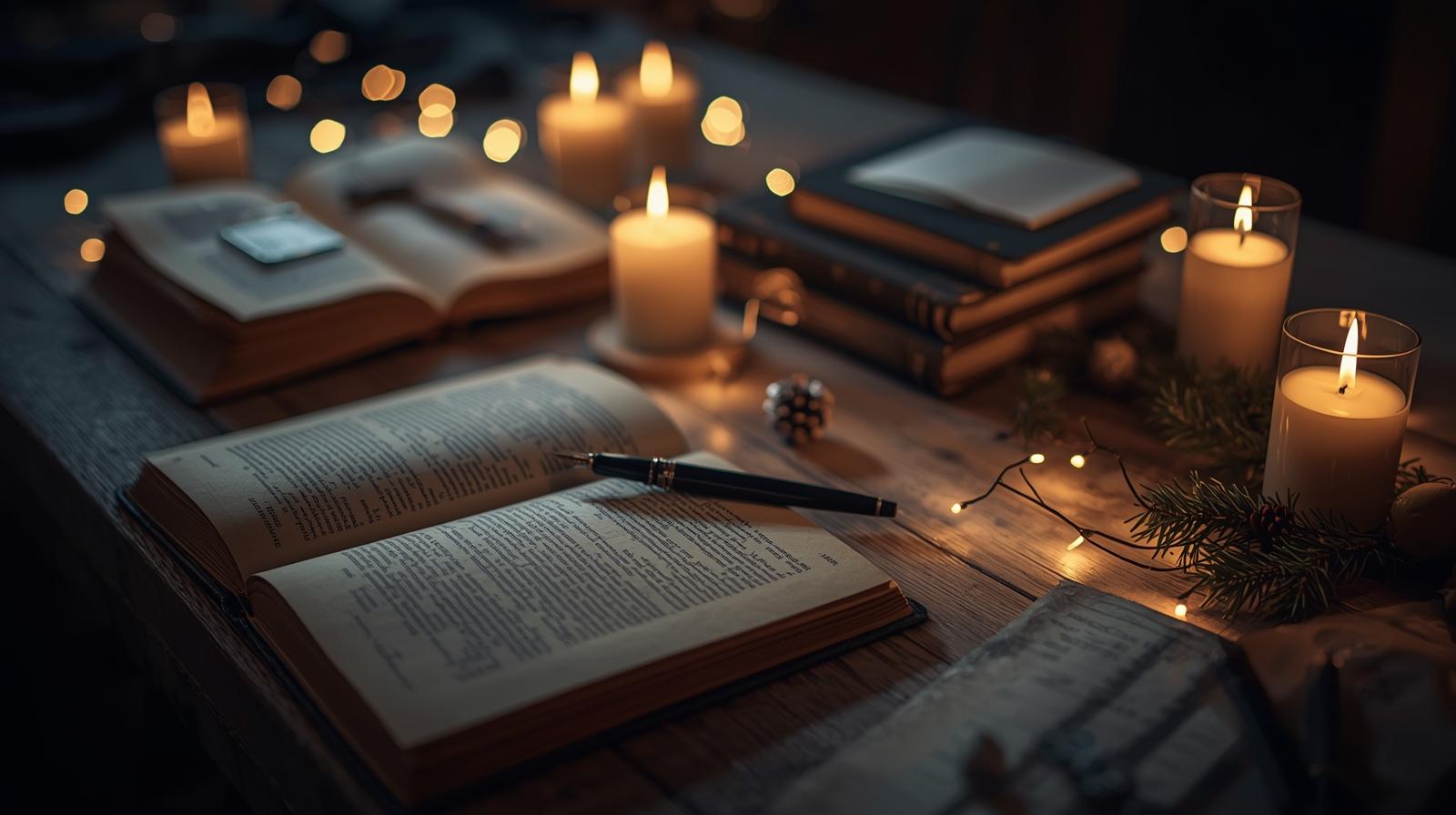

Kommentare
0 Kommentare
Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.