13. Juni 2024
Erschwinglichkeit von Wohnraum – Eine Literaturübersicht
Um das Ausmass eines potenziellen Wohnraumerschwinglichkeitsproblems sowohl national als auch international beurteilen zu können, muss zunächst die Frage nach der Definition geklärt werden: Was bedeutet Erschwinglichkeit von Wohnraum? Obwohl diese Frage auf den ersten Blick simpel erscheint, gibt es jedoch keine einfache und prägnante Antwort darauf. Eine Durchsicht der Literatur, die im folgenden Artikel zusammengefasst wird, verdeutlicht die Komplexität dieses Themas.

Ein Artikel von Valentina Maras
Einleitung
Die Erschwinglichkeit von Wohnraum[1] ist ein breit erforschtes Thema und eine der zentralen Fragen in der Wohnungsforschung, die jedoch in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Viele AutorInnen haben in jüngster Zeit ein Wiederaufleben des Themas festgestellt, bedingt durch den Anstieg der Immobilienpreise und Mieten. Diese Einschätzung wird auch durch die schnell wachsende Zahl von Veröffentlichungen zu diesem kritischen Thema bestätigt (Anacker, 2019; Lee et al., 2022; Peverini, 2023).
Auch das öffentliche Bewusstsein für die Erschwinglichkeit von Wohnraum, insbesondere in (wachsenden) Städten, hat in letzter Zeit stark zugenommen. Ohnehin wird das Thema der Wohnraumerschwinglichkeit zunehmend als ein städtisches Problem wahrgenommen. So betont Wetzstein (2017), dass nach der globalen Finanzkrise eine weitere globale Krise im Gange sei, nämlich die globale Krise der Erschwinglichkeit von Wohnraum in Städten (Haffner und Hulse, 2021a; Peverini, 2023; Wetzstein, 2017).
Insgesamt ergibt sich, dass bei der Beurteilung der Erschwinglichkeit von Wohnraum nicht nur die direkten Wohnkosten, sondern unter anderem auch die finanzielle Situation der Haushalte sowie die weiteren Lebenshaltungskosten eine wesentliche Rolle spielen. Wie Stone (2006a) betont, ist Erschwinglichkeit keine inhärente Eigenschaft des Wohnraums selbst, sondern immer eine Beziehung zwischen Wohnraum und Menschen beziehungsweise Haushalten. Die Erschwinglichkeit kann also nicht allein anhand des Hauspreises oder der Miete gemessen werden, da erschwinglicher Wohnraum für jede Person etwas anderes sein wird, je nach finanziellen Umständen unter anderem. Daraus folgt, dass selbst Mieten unter dem Marktwert per se nicht zwangsläufig für alle Haushalte erschwinglich sind (Earl et al., 2017; Stone, 2006a; Stone et al., 2011). Napoli (2017) fasst es wie folgt zusammen: Erschwinglichkeit und mangelnde Erschwinglichkeit von Wohnraum sind immer das Ergebnis einer Wechselwirkung zwischen Menschen und dem Wohnraum (sei es der Kaufpreis oder die Miete). Bei gleichem Einkommen werden diese Beziehungen durch Schwankungen auf dem Immobilienmarkt und durch Wohnungstypen beeinflusst. Bei gleichem Preis variieren diese Beziehungen aber je nach Haushaltstyp, Einkommensklasse, Wohnungskauf und Miete (Napoli, 2017). Diese Unterschiede sind also für die Bewertung der Erschwinglichkeit von Wohnraum relevant. Napoli (2017) fügt weiter hinzu, dass folglich die spezifischen Einkommensgruppen, auf die sich das Mass der Erschwinglichkeit bezieht, sowie der Standard der Erschwinglichkeit vorab definiert werden müssen (Napoli, 2017). Eindimensionale Konzepte wie Marktbenchmarks oder Kostenmieten können somit irreführend sein, da sie nicht das individuelle Einkommen noch sonstige Bedingungen und Charakteristiken eines Haushalts berücksichtigen.
Zunehmende Besorgnis um die Erschwinglichkeit von Wohnraum
Die Erschwinglichkeit von Wohnraum ist seit langem ein Thema für politische Entscheidungsträger und Regierungen weltweit. Thalmann (2003, S.291) stellte bereits zu Beginn des 21. Jahrhunderts fest: «In those countries where housing standards and supply are generally adequate, affordability has become the central concern of housing policy, topping the lack of amenities and overcrowding.».
In den letzten Jahren haben sich diese Sorgen jedoch verschärft, da der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zunehmend schwieriger geworden ist (Ben-Shahar et al., 2019). Auch in der Schweiz wird die Wohnungsfrage immer stärker thematisiert und politisiert. Vor allem für die mittleren und unteren Einkommensgruppen in den städtischen Gebieten wird hierzulande das Wohnen immer weniger erschwinglich (Glaser, 2017; Wicki et al., 2024).
Zwei wesentliche Faktoren tragen zur steigenden öffentlichen Besorgnis über die Erschwinglichkeit von Wohnraum bei. Erstens stellen die Wohnkosten für die meisten Haushalte den grössten Ausgabenposten dar. Haushalte im obersten Einkommensquintil der OECD geben im Schnitt etwa ein Viertel ihres Einkommens für Wohnkosten aus, während ärmere Haushalte oft einen noch grösseren Anteil ihres Einkommens dafür aufwenden (rund 37% im untersten Einkommensquintil). Bereits geringere Preissteigerungen bei Mieten und Hauspreisen können daher erhebliche Auswirkungen auf die Konsumausgaben und den Lebensstandard der Haushalte haben (Mineshima et al., 2021; OECD, 2021; Quigley und Raphael, 2004).
Zweitens sind die Wohnkosten in den letzten zwei Jahrzehnten gestiegen, überwiegend für Mietende. In der Schweiz ist insbesondere in städtischen Gebieten ein deutlicher Anstieg der Mieten zu beobachten. Insgesamt hat die Schweiz in letzter Zeit einen (öffentlich) viel beachteten Anstieg der Immobilienpreise- und mieten erlebt, wobei beispielsweise der Anstieg des Referenzzinssatzes im Juni 2023 auf 1.5% ein entscheidender Wendepunkt war (Debrunner et al., 2024; Lutz et al., 2023; Rentsch, 2023; Wicki et al., 2024).
In 31 OECD-Ländern, einschliesslich der Schweiz, sind zwischen 2005 und 2019 die realen Hauspreise angestiegen, ebenso wie die Mieten in nahezu allen OECD-Ländern, ebenfalls einschliesslich der Schweiz. Solche Preissteigerungen bei Wohnraum können sich direkt auf die finanziellen Belastungen der Haushalte auswirken. So ist beispielsweise in den 20 OECD-Ländern[2] der Anteil der Wohnausgaben am Haushaltsbudget zwischen 2005 und 2015 im Durchschnitt um nahezu 5 Prozentpunkte angestiegen (OECD, 2021; Quigley und Raphael, 2004).
Erschwinglichkeit von Wohnraum – Ein komplexer und vielschichtiger Begriff
Um das Ausmass eines potenziellen Erschwinglichkeitsproblems angesichts der zunehmenden Besorgnis zu beurteilen und gegebenenfalls geeignete Massnahmen einzuleiten, ist eine genaue Messung der aktuellen Wohnkostenbelastung der Haushalte erforderlich (Meen, 2018). Wie politische Entscheidungsträger die Erschwinglichkeit von Wohnraum am besten beurteilen können, ist jedoch komplex. Es besteht zwar Einigkeit darüber, dass der Mangel an erschwinglichem Wohnraum ein kritisches Problem darstellt, doch gibt es keinen internationalen Konsens darüber, was erschwinglicher Wohnraum eigentlich ist und wie er am besten gemessen werden kann (Ezennia und Hoskara, 2019; Galster und Lee, 2021a; Mazacek, 2023; Mineshima et al., 2021; OECD, 2021).
Earl et al. (2017) kommen zum Schluss, dass die Erschwinglichkeit von Wohnraum ein komplexer und vielschichtiger Begriff ist. Bereits Quigley und Raphael (2004) definierten die Erschwinglichkeit von Wohnraum als einen komplexen Begriff, der eine Reihe unterschiedlicher Aspekte umfasst wie Einkommensverteilung, Verschuldungsfähigkeit der Haushalte, Einfluss der öffentlichen Politik auf Wohnungsmärkte, Bedingungen des Wohnungsangebots und individuelle Konsumentscheidungen beziehungsweise individuelle Präferenzen der Haushalte (Entscheidungen der Individuen darüber, wie viel Wohnraum sie im Verhältnis zu anderen Gütern konsumieren wollen) (Galster und Lee, 2021b, 2021a; Haffner und Heylen, 2011; Quigley und Raphael, 2004). Ezennia und Hoskara (2019) betonen ebenfalls, dass der Begriff der Wohnraumerschwinglichkeit ‚polysem'[3] ist. So wird dieser zur Beschreibung verschiedener Komponenten des Wohnbedarfs verwendet wie beispielsweise Wohnzustand, Wohnkosten, Wohnqualität, Haushaltseinkommen sowie Überbelegung und ist folglich (aufgrund des heuristischen Charakters) zu einem vielschichtigen Begriff geworden.
Neben dieser Komplexität und Vielschichtigkeit des Begriffs kommt zusätzlich hinzu, dass die Beurteilung der Erschwinglichkeit von Wohnraum teilweise subjektive Einschätzungen erfordert. Beispielsweise bei Fragen wie, ob Haushalte, die einen kleineren Teil ihres Einkommens für Wohnraum ausgeben, aber in minderwertigen Wohnobjekten oder unsicheren Gegenden leben, dennoch als von Erschwinglichkeitsproblemen betroffen gelten sollten (Belsky et al., 2005).
Geschichtlicher Hintergrund
Die Thematik der Erschwinglichkeit von Wohnraum reicht über 150 Jahre zurück, als Friedrich Engels bereits in den 1870er Jahren über ‚The housing question‘ schrieb. Heutzutage sprechen WissenschaftlerInnen von einer Rückkehr der Wohnungsfrage, besonders seit der globalen Finanzkrise von 2008 (Engels, 2021; Peverini, 2023). Historisch stammten die meisten Studien zur Erschwinglichkeit aus dem anglophonen Raum, mittlerweile wird das Thema jedoch global betrachtet und findet zunehmend Eingang in internationale und europäische Diskussionen (Haffner und Hulse, 2021b; Peverini, 2023). Gemäss Haffner und Hulse (2021) lässt sich die Debatte über die Erschwinglichkeit von Wohnraum in drei Hauptphasen unterteilen:
Erste Phase (spätes 19. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhundert)
Frühe Messungen der Wohnraumerschwinglichkeit wurden durch Forschungen zu Lebenshaltungskosten und Armut geprägt. Konzepte wie das US-amerikanische «one week’s pay for one month’s rent» (Hulchanski, 1995, S.475), basierend auf den Arbeiten von Ernst Engel und Herman Schwabe zur Beziehung zwischen Haushaltsausgaben und Einkommen (sogenannte Engel-Kurve), legten den Grundstein für moderne Erschwinglichkeitskonzepte. Trotz zahlreicher empirischer Studien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts blieben konzeptionelle und praktische Schwierigkeiten bestehen, unter anderem bei der Definition von Wohnkosten und Einkommen (Haffner und Hulse, 2021b; Meen, 2018; Peverini, 2023).
Zweite Phase (zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts)
Die Erschwinglichkeit rückte im Zusammenhang mit Budgets (d.h. dem Gesamteinkommen, das für alle relevanten Bedürfnisse benötigt wird) in den Fokus. Hierbei wurde erstmals die Rolle der Ausgaben für Wohnraum im Verhältnis zu anderen Lebenshaltungskosten und der Armut untersucht. Dies führte zu einem neuen Ansatz, bei dem die zentrale Frage ist, ob das verbleibende Einkommen nach Abzug der Wohnkosten ausreicht, um ein anständiges Leben zu führen (Haffner und Hulse, 2021; Peverini, 2023).
Dritte Phase (seit Anfang des 21. Jahrhunderts)
Besonders nach der globalen Finanzkrise wurde die Erschwinglichkeit von Wohnraum und das damit verbundene Wissen erneut hinterfragt. Haffner und Hulse (2021) betonen, dass der Begriff ‚Erschwinglichkeit von Wohnraum‘ heute viel komplexer und mehrdimensionaler ist als in den vorherigen Jahrhunderten. Neuerdings erforschen WissenschaftlerInnen die urbanen Dimensionen der Erschwinglichkeit und sprechen explizit von urbaner Wohnraumerschwinglichkeit (Haffner und Hulse, 2021; Peverini, 2023).
Heute existieren nach vielen Jahrzehnten der Diskussion und Forschung eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen und Konzepte zur Erschwinglichkeit von Wohnraum. Diese Vielfalt hat zu einem sogenannten «methodological chaos» geführt (Ezennia und Hoskara 2019, S.22). Galster und Lee (2021) argumentieren, dass diese Inkonsistenzen verständlich sind, da eben die Erschwinglichkeit von Wohnraum ein komplexer oder gar ein besonders ‚ärgerlicher‘ (Wilcox, 1999) und ’schlüpfriger‘ (Bourassa, 1996) Begriff sei, der aber wiederum klar und auf eine Weise definiert werden muss, die allgemeine Zustimmung findet (Galster und Lee, 2021).
Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher und teilweise widersprüchlicher Definitionen und Interpretationen zur Wohnraumerschwinglichkeit empfehlen Ezennia und Hoskara (2019), dass eine dringende Aufgabe der zukünftigen Literatur zur Wohnraumerschwinglichkeit darin besteht, diese Verwirrung über die Definitionen, Konzepte und Messansätze der Erschwinglichkeitsanalyse zu lösen.
Wichtige Definitionen und Konzepte der Wohnraumerschwinglichkeit
Im Einklang mit dieser Komplexität wird in der Literatur zunehmend versucht, bei der Frage nach Wohnraumerschwinglichkeit mehr als nur das Verhältnis zwischen den direkten Wohnkosten und dem Haushaltseinkommen zu berücksichtigen (Earl et al., 2017). Auf die Frage, was Wohnraumerschwinglichkeit ist, antwortet Stone (2006): «Most fundamentally, it is an expression of the social und material experiences of people, constituted as households, in relation to their individual housing situations.» (Stone, 2006, S.151). Weiter hält Stone (2006a) fest, dass Wohnraumerschwinglichkeit die Herausforderung ausdrückt, die jeder Haushalt hat, wenn es darum geht, die Kosten für den tatsächlichen oder potenziellen Wohnraum einerseits und die sonstigen Ausgaben andererseits innerhalb der Grenzen des Einkommens auszugleichen (Heylen und Haffner, 2013; Stone, 2006a). Zudem führen Stone et al. (2011) weiter aus, dass die Erschwinglichkeit von Wohnraum ein Konzept ist, das auf der Beziehung zwischen Haushalten und ihren Wohnräumen beruht. Folglich ist die Erschwinglichkeit keine inhärente Eigenschaft des Wohnobjekts selbst, sondern hängt immer von der individuellen finanziellen Situation der Haushalte ab. Die Autoren fügen hinzu, dass für einige Menschen jede Wohnung bezahlbar ist, unabhängig vom Preis oder der Miete, wohingegen für andere Menschen keine Wohnung erschwinglich ist, es sei denn, sie wird kostenlos angeboten (Stone 2006a; Stone et al. 2011). Die Erschwinglichkeit kann also nicht allein anhand des Hauspreises oder der Miete gemessen werden, da erschwinglicher Wohnraum für jede Person je nach finanziellen Umständen unterschiedlich ist. Selbst Preise oder Mieten unter dem Marktwert sind daher nicht zwangsläufig für alle Haushalte erschwinglich. Begriffe wie erschwinglicher oder bezahlbarer Wohnraum sind daher für solche Wohnobjekte mit einem Preis oder einer Miete unterhalb des Marktwerts nicht ganz zutreffend, da sie die Erschwinglichkeit für alle implizieren. Solche Begriffe, im Englischen ‚affordable housing‘, machen laut den Autoren nur dann Sinn, wenn unter anderem die wesentliche Frage ‚Für wen erschwinglich?‚ gleichzeitigt beantwortet wird (Earl et al., 2017; Stone, 2006a, 2006b; Stone et al., 2011).
Gemäss Heylen und Haffner (2013) betonen unter anderem Hancock (1993) und Freeman et al. (2000), dass die Definition der Erschwinglichkeit auch Qualitätsstandards für Wohnraum berücksichtigen muss. Denn häufig sind zu kleine Wohnungen oder fehlender Komfort keine freie Wahl, sondern vielmehr ein Zwang, weil eine angemessene Wohnung zu einem erschwinglichen Preis nicht erreichbar ist (Freeman et al., 2000; Hancock, 1993; Heylen und Haffner, 2013).
Diese Aspekte wurden bereits von Maclennan und Williams (1990) in ihrer Definition der Erschwinglichkeit berücksichtigt. Laut dieser Definition bedeutet Erschwinglichkeit, einen bestimmten Wohnstandard zu einer Miete oder einem Preis zu sichern, welche/r nach Ansicht eines Dritten (meistens der Regierung) keine unzumutbare Belastung für das Haushaltseinkommen darstellt. Bramley (1990) führte weiter aus, dass Haushalte in der Lage sein sollten, eine Wohnung zu bewohnen, die den etablierten (Sozialwohnungs-)Normen der Angemessenheit (bei gegebenem Haushaltstyp und -grösse) entspricht, und zwar zu einer Nettomiete, die ihnen ein ausreichendes Einkommen zum Leben lässt, ohne dass sie unter einen bestimmten Armutsstandard fallen. Gemäss Hancock (1993) scheinen beide Definitionen die Nichtwohngüter als ein meritorisches Gut[4] zu betrachten, d.h. es gibt eine bestimmte Menge an Nichtwohngüter, welche aus Sicht der Gesellschaft als sozial erwünschtes Minimum gilt. Bei Bramley (1990) ist es ein Armutsstandard während Maclennan und Williams (1990) von einer ‚unzumutbaren Belastung‘ sprechen. Hancock (1993) ergänzt weiter, dass beide Definitionen die Opportunitätskosten des Wohnens betrachten, was auch die Essenz des Konzepts der Erschwinglichkeit von Wohnraum sei. Bereits Whitehead (1991) definierte Erschwinglichkeit als die Opportunitätskosten von Wohnraum im Vergleich zu anderen Nichtwohngütern. Bei den Opportunitätskosten des Wohnens geht es also darum, worauf Haushalte verzichten müssen, um Wohnraum zu erwerben oder zu mieten und inwiefern dieser Verzicht angemessen oder unverhältnismässig ist (Hancock, 1993, S. 129).
Ähnlich sieht es die OECD (2021), welche die Erschwinglichkeit von Wohnraum im weitesten Sinne als die Fähigkeit von Haushalten definiert, angemessenen Wohnraum zu kaufen oder zu mieten, ohne dadurch ihre Fähigkeit zu beeinträchtigen, weitere grundlegende Lebenshaltungskosten zu decken.
Relevante Elemente der Wohnraumerschwinglichkeitsanalyse
Galster und Lee (2021) fassen zusammen[5], dass sich jede Definition der Erschwinglichkeit von Wohnraum für einen einzelnen Haushalt auf drei Elemente beziehen sollte: die Preise für Wohn- und Nichtwohngüter, die finanziellen Mittel des Haushalts, um diese Güter zu bezahlen, und einen normativen Standard, der die minimal akzeptablen Mengen an Wohn- und Nichtwohngütern festlegt, die ein Haushalt konsumieren können sollte. Folglich kann die Erschwinglichkeit nur dann sinnvoll bestimmt werden, wenn in einer Gesellschaft festgelegt wird, was als minimal angemessener Konsum gilt, den alle BürgerInnen aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit erreichen sollten (Galster und Lee, 2021a).
Haffner und Heylen (2011) dagegen sind der Ansicht, dass neben dem Preis oder der Miete zwei weitere Faktoren erforderlich sind, um den Grad der Erschwinglichkeit von Wohnraum für Haushalte zu bestimmen. Der erste ist ein Standard für die Angemessenheit des Preises, der für Wohnkonsum im Verhältnis zum Einkommen gezahlt wird. Mit diesem Standard kann festgestellt werden, wie gross die Gruppe der Haushalte ist, für die Wohnen potenziell nicht erschwinglich ist. Ohne einen Standard für die zu konsumierende Wohnqualität ist es jedoch nicht möglich, sicherzustellen, ob Wohnraum tatsächlich unerschwinglich ist, da die Qualität des Wohnraums diese Bewertung beeinflusst (Haffner und Heylen, 2011; Heylen und Haffner, 2013; Thalmann, 2003). Denn Wohnraum kann unerschwinglich sein aufgrund von Überkonsum (z.B. grosse Wohnfläche, qualitativ hochwertiger Wohnraum), während er aufgrund von Unterkonsum erschwinglich sein kann. Unterkonsum tritt auf, wenn Haushalte in minderwertigen oder zu kleinen Wohnungen im Verhältnis zur Haushaltsgrösse leben (Überbelegung). Wenn es sich dabei um eine persönliche Entscheidung handelt, dann ist es kein Erschwinglichkeitsproblem. Auch bei Überkonsum liegt kein Erschwinglichkeitsproblem vor. Unerschwinglichkeit liegt hingegen bei Zwängen vor, etwa bei der Entscheidung zwischen Wohnen oder anderen Ausgaben und entweder dem Unterkonsum von Wohnraum oder der unzureichenden Deckung anderer Bedürfnisse. Dies wird auch als ‚Shelter Poverty‘ bezeichnet (Haffner und Heylen, 2011; Heylen und Haffner, 2013; Stone, 2006b, S.459; Stone, 2006a).
Trotz der Beachtung, die diesem Qualitätsmerkmal in der Literatur zugeteilt wird, bleibt es aber in vielen Analysen zur Erschwinglichkeit unberücksichtigt (Haffner und Heylen, 2011; Heylen und Haffner, 2013).
Messkonzepte zur Bewertung der Wohnraumerschwinglichkeit – Überblick über verschiedene Ansätze
Es gibt verschiedene Ansätze, die zur Bewertung der Erschwinglichkeit von Wohnraum verwendet werden können, wobei die gebräuchlichsten der Verhältnisansatz und der Residualeinkommensansatz sind (Heylen und Haffner, 2013; Napoli, 2017). Nachfolgend eine (nicht abschliessende) Zusammenfassung bekannter Messkonzepte.
Income Ratio Approach (Verhältnisansatz): Wie viel kostet das Wohnen im Verhältnis zum Einkommen?
Der älteste und bekannteste Ansatz zur Beurteilung der Wohnraumerschwinglichkeit ist der sogenannte ‚Income Ratio Approach‘. Abhängig von den betrachteten Wohnkosten ergeben sich verschiedene Varianten wie beispielsweise die Housing-Expenditure-To-Income Ratio, Housing-Price-To-Income Ratio, Rent-To-Income Ratio oder Debt-To-Income Ratio (Ezennia und Hoskara, 2019; OECD, 2021). Bei all diesen Varianten werden die Wohnkosten jeweils ins Verhältnis zum Einkommen gesetzt[6] (Aubele et al., 2023; Heylen, 2023; Heylen und Haffner, 2013; Peverini, 2023).
Eine gängige Faustregel ist die 30%- oder 1/3-Schwelle, bei der Wohnraum als erschwinglich gilt, wenn die Haushalte nicht mehr als 30% beziehungsweise ein Drittel ihres Bruttoeinkommens für Wohnkosten ausgeben. Weitere Beispiele für Schwellenwerte: Eurostat und die OECD setzen die Überlastungsschwelle bei 40% des verfügbaren Einkommens beziehungsweise bei 30% des Bruttoeinkommens und beziehen sich jeweils auf die Bruttomiete. In den USA gilt Wohnraum als erschwinglich, solange die Bruttomiete höchstens 30% des Vorsteuereinkommens (‚pre-tax income‘) beträgt, während in der Schweiz dieser Schwellenwert gemäss Debrunner und Hartmann (2020) bei 25% des Nettoeinkommens liegt (Belsky et al., 2005; Mazacek, 2023; OECD, 2021; Peverini, 2023; Reynolds, 2011).
Weiterentwicklung des klassischen Income Ratio Approach
Einige Länder haben den klassischen Verhältnisansatz weiterentwickelt. In Australien gilt beispielsweise die 30:40-Regel, die nur Haushalte in den unteren beiden Einkommensquintilen (untere 40%) berücksichtigt, die mehr als 30% ihres Einkommens für Wohnraum ausgeben (‚Low Income Renter Affordability Index‘) (Meen, 2018).
Der Nurse-Index[7] in Norwegen misst die Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit von Wohnraum anhand der Anzahl der Wohneinheiten, die für eine Pflegekraft (bzw. ’nurse‘) mit einem durchschnittlichen Jahreslohn potenziell erschwinglich wären gemäss dem klassischen Income Ratio Approach[8]. Folglich deutet eine hohe Anzahl auf das Fehlen von Erschwinglichkeitsproblemen hin (Peverini, 2023).
In der Literatur wird zudem vermehrt versucht, standortbezogene Faktoren bei der Erschwinglichkeit von Wohnraum zu berücksichtigen. Vor allem hat die Literatur versucht, die Transportkosten einzubeziehen. Dieses sogenannte ‚Location Affordability‘ Konzept berücksichtigt im Zähler des klassischen Verhältnisansatzes neben den Wohnkosten auch die mit dem Standort verbundenen Kosten wie Transportkosten. Ein Beispiel hierfür ist der US Housing and Transportation (H+T®) Affordability Index (Peverini, 2023).
Kritik am klassischen Verhältnisansatz
Der klassische Verhältnisansatz wird aber auch kritisiert, da er beispielweise das absolute Verbrauchsniveau nicht berücksichtigt. Haushalte mit niedrigem Einkommen, die nur 10% oder 20% ihres Einkommens für Wohnkosten ausgeben, könnten dennoch wenig Geld für andere wichtige Güter und Dienstleistungen haben. Die Faustregel tendiert dazu, das gleiche Verhältnis für jeden Haushaltstyp und jeden Konsumstandard anzuwenden und berücksichtigt damit nicht die Ausgaben- und Einkommensunterschiede zwischen verschiedenen Haushaltstypen (Heylen und Haffner, 2013; Napoli, 2017; OECD, 2021). Deshalb wird vorgeschlagen, zumindest eine differenzierte Kennzahl für unterschiedliche Einkommensgruppen und Haushaltstypen zu haben, um die «comedy of errors» (Hulchanski 1995, S.474) zu vermeiden, die entsteht, wenn unabhängig von Einkommen und Haushaltstyp nur ein Standard für alle verwendet wird (Hulchanski, 1995; Peverini, 2023).
Darüber hinaus fehlt eine normative Basis für die Schwellenwerte. Die Festlegung, dass beispielsweise 30% des Einkommens für Wohnkosten akzeptabel sind, ist vielmehr eine historisch gewachsene Faustregel und keine statistisch fundierte Norm. Zudem gibt es auch keine einheitlichen Standards für die Messung der Einkommen (z.B. Brutto oder Netto) und Wohnkosten (z.B. inklusive oder exklusive Nebenkosten) (Brooks, 2023; Mazacek, 2023; Peverini, 2023).
Eine hohe Kosten-Einkommens-Relation kann schliesslich auch bedeuten, dass ein Haushalt viel oder hochwertigen Wohnraum bevorzugt. Haushalte mit hohem Einkommen könnten trotz hoher Wohnkosten genug Geld für andere notwendige Bedürfnisse haben, weshalb eine hohe Kostenbelastung nicht unbedingt besorgniserregend ist (Kutty, 2005). Allgemein werden Qualitätsmerkmale beim klassischen Verhaltensansatz nicht mitberücksichtigt, was zu Fehlinterpretationen führen kann (OECD, 2021).
Aufgrund dieser Mängel wird in der Literatur als Alternative zum herkömmlichen Verhältnisansatz der sogenannte ‚Residual Income Approach‘ vorgeschlagen.
Residual Income Approach (Residualeinkommensansatz): Wie viel Geld bleibt nach den Wohnkosten übrig?
Der Residual Income Approach betrachtet die Erschwinglichkeit von Wohnraum aus der Perspektive der Ausgaben, die nicht für Wohnen verwendet werden, und zeigt somit die Wechselwirkung zwischen Wohnkosten, Einkommen und anderen Ausgaben. Dieser Ansatz konzentriert sich auf das Einkommen, das einem Haushalt nach Zahlung der Wohnkosten verbleibt (genannt Residualeinkommen) und verdeutlicht so die absoluten Konsmumöglichkeiten nach Abzug der Wohnkosten (Hancock, 1993; Heylen und Haffner, 2013; OECD, 2021).
Der Ansatz basiert auf der Überlegung, dass es für Haushalte nicht entscheidend ist, welchen Anteil ihres Einkommens sie für Wohnraum ausgeben, sondern ob sie nach den Wohnkosten noch genügend Einkommen für andere notwendige Ausgaben haben. Heylen und Haffner (2013) argumentieren zudem, dass Wohnkosten einen anderen Charakter haben als beispielsweise Ausgaben für Lebensmittel oder Kleidung. Da die Wohnkosten in der Regel den grössten und am wenigsten flexiblen Teil des Haushaltsbudgets beanspruchen, ist es somit gemäss den Autoren sinnvoll, das verbleibende Einkommen nach Abzug der Miet- oder Hypothekenzahlungen zu analysieren (Heylen und Haffner, 2013; OECD, 2021).
Ein Anwendungsbeispiel des Residual Income Approach ist der Shelter Poverty–Indikator. Dieser beschreibt Haushalte als ’shelter poor‘, wenn nach Abzug der Wohnkosten nicht genügend Einkommen vorhanden ist, um einen (sozial akzeptablen) Mindestwarenkorb an Nichtwohnkosten zu decken. Shelter Poverty kann somit als eine Form der Armut betrachtet werden, die sich aus der Kombination von hohen Wohnkosten und unzureichendem Einkommen ergibt, und nicht nur aus einem begrenzten Einkommen (Stone, 2006b; Stone et al., 2011).
Insgesamt umgeht dieser Ansatz einige (nicht alle) der Kritikpunkte am Income Ratio Approach, weist jedoch auch eigene Schwächen auf. So leidet er unter anderem selbst an Willkürlichkeit, da es keine einfache Möglichkeit oder Standardmethode gibt, das Mindesteinkommen zu quantifizieren, das Haushalte für andere Ausgaben benötigen. Dieser Mindestverbrauch kann auch als subjektiv angesehen werden und kann beispielsweise je nach Einkommensklasse, Region und Stadt variieren. Zudem wird der Residual Income Approach von einigen Autoren kritisiert, da er mit der Armutsmessung verwechselt werden könnte (Ezennia und Hoskara, 2019; OECD, 2021).
Wohnungsqualitätsindikatoren und weitere Messkonzepte
Wohnungsqualitätsindikatoren helfen zu bewerten, wofür Haushalte in Bezug auf Wohnqualität und Standards bezahlen. Die Überbelegungsrate beispielsweise misst, ob Wohnungen genügend Platz bieten, gemessen an der Anzahl der Räume pro Haushaltsmitglied. Wohnungsdeprivationsraten messen Wartungsmängel (z.B. undichte Dächer, feuchte Wände, usw.) und das Fehlen wesentlicher Ausstattungen. Solche Qualitätsmessungen sind im unteren Einkommensbereich besonders relevant, da diese Haushalte eher in minderwertigen Wohnobjekten leben. Die Wohnqualität wird in den beiden vorgestellten Messkonzepten nicht berücksichtigt, wäre jedoch eine wichtige Ergänzung zu Erschwinglichkeitsmessungen, wie bereits zuvor erläutert wurde (OECD, 2021; Peverini, 2023).
Andere Ansätze wie das ‚Below Market‘-Konzept definieren erschwinglichen Wohnraum als Wohnungen, deren Miete oder Kaufpreis unter dem Marktniveau liegt. In Grossbritannien beispielsweise definiert das ‚National Planning Policy Framework 2019‘ bezahlbaren Wohnraum als Wohnungen, die zu einem Mietpreis angeboten werden, der mindestens 20% unter den lokalen Marktpreisen liegt.
Dagegen basiert das Konzept der Kostenmiete (‚Cost-Rent‘) lediglich auf der Summe der Produktionsfaktoren sowie der Instandhaltungskosten und impliziert somit den Verzicht auf Gewinn oder Mehrwert. Das österreichische Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz zum Beispiel schreibt vor, dass Genossenschaften und gemeinnützige Bauträger die Mieten ausschliesslich auf Basis der Produktions- und Instandhaltungskosten kalkulieren müssen (Peverini, 2023). Wie jedoch eingangs bereits erwähnt, ist gemäss Stone (2006a;2011) die Erschwinglichkeit keine Eigenschaft von Wohnraum selbst, sondern immer eine Beziehung zwischen Wohnraum und Haushalt und kann folglich nicht allein anhand des Hauspreises oder der Miete gemessen werden.
Zwei weitere, aber eher selten verwendete Ansätze sind der Verhaltensansatz (‚Behavioral Approach‘) und der subjektive Ansatz (‚Subjective Approach‘). Ersterer bewertet die Erschwinglichkeit von Wohnraum anhand der tatsächlichen Wohnentscheidungen und Ausgabemuster von Haushalten. Der subjektive Ansatz erfasst die individuellen Wahrnehmungen der Haushalte über ihre Wohnsituation. Beide Ansätze bringen teilweise grössere Herausforderungen betreffend Datenverfügbarkeit mit sich (Ezennia und Hoskara, 2019).
Neuere Studien empfehlen, neben wirtschaftlichen auch ökologische (z.B. ökologische Auswirkungen der Wohngebiete und deren Beitrag zur Gesundheit der Bewohnenden) und soziale (z.B. soziales Wohlbefinden oder Qualität und Sicherheit der Nachbarschaft/des Standorts) Aspekte in die Erschwinglichkeitsbewertungen einzubeziehen (Ezennia und Hoskara, 2019). Dadurch steigt die Komplexität, aber dafür wird die tatsächliche Erschwinglichkeit erfasst. Gemäss Haffner und Hulse (2021) ist das, was wir im 21. Jahrhundert unter Erschwinglichkeit von Wohnraum verstehen, ohnehin viel komplexer und mehrdimensionaler als noch im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert.
Schlusswort
Die Erschwinglichkeit von Wohnraum ist also sowohl in akademischen als auch in öffentlichen und politischen Kreisen ein stark diskutiertes Thema, bleibt jedoch gleichzeitig oft ein unklarer und ungenauer Indikator für die Wohnsituation der Haushalte (Peverini, 2023). Schliesslich hängt die Beziehung zwischen Wohnen und wirtschaftlichen Bedingungen der Haushalte (also die Wohnsituation) stark davon ab, wie Erschwinglichkeit überhaupt definiert und gemessen wird, was letztlich direkte Auswirkungen auf die Gestaltung der öffentlichen Politik hat. Daher sollte eine umfassende Wohnungserschwinglichkeitspolitik idealerweise Elemente aus möglichst vielen der heute vorhandenen Konzepte kombinieren und sich nicht nur auf einen einzigen Ansatz beschränken (Peverini, 2023). In Anlehnung an die Definition von Stone (2006a,b; Stone et al. 2011), dass die Erschwinglichkeit von Wohnraum immer eine Beziehung zwischen Wohnraum und Haushalt ist, kommen Earl et al. (2017) zum Schluss: «Thus, it is advisable that the methodology for measuring affordability should sufficiently take into account all the human variables that such a relational concept implies.» (Earl et al. 2017, S.6).
Fussnoten:
[1] In englischsprachiger Fachliteratur als «Housing Affordability» bezeichnet. Im Deutschen werden mehrere Begriffe synonym verwendet wie z.B. Leistbarkeit, Bezahlbarkeit, Tragbarkeit oder eben Erschwinglichkeit von Wohnraum.
[2] Zu den 20 OECD-Ländern zählen Österreich, Belgien, die Tschechische Republik, Finnland, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Litauen, Luxemburg, Lettland, die Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, die Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden und die Türkei.
[3] Mehrere Bedeutungen habend, vieldeutig.
[4] Ein meritorisches Gut bedeutet, dass das Angebot oder die Nachfrage ohne staatliche Eingriffe nicht das gesellschaftlich gewünschte Mass erreichen.
[5] Unter anderem basierend auf den Arbeiten von Hancock (1993) und (Thalmann, 2003, 1999).
[6] Neben der Verwendung in der Wohnungsforschung wird dieser Ansatz auch häufig im Finanzsektor (z.B. zur Bewertung der Liquidität eines potenziellen Hypothekenschuldners) und im sozialen Wohnungsbau eingesetzt.
[7] Laut Peverini (2023) gehört dieser Index in das sogenannte ‚Housing Accessibility‘ Konzept.
[8] Entspricht in etwa dem nationalen Durchschnittslohn.
Das Literaturverzeichnis ist hier zu finden.
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:
Entdecken Sie die Welt des Immobilienmanagements und erfahren Sie alles Wissenswerte rund um den MAS Immobilienmanagement und andere Angebote zum Thema Immobilien. Gerne beantworten Ihnen Prof. Dr. Markus Schmidiger und Prof. Dr. John Davidson vom IFZ Ihre Fragen.
Der neue CAS Real Estate Investment Management befähigt Sie, erfolgreich in Immobilien zu investieren und Immobilienportfolien erfolgreich zu führen. Melden Sie sich hier an.
Mit dem MAS Immobilienmanagement werden Sie zum Generalisten und sind in der Lage, anspruchsvolle Fach- und Führungsaufgaben rund um das Immobilienmanagement erfolgreich zu übernehmen. Melden Sie sich hier an.
Master of Science in Real Estate – Die Ausbildung für künftige Führungskräfte in der Immobilienbranche.
Das Studium des Master of Science in Real Estate bereitet auf anspruchsvolle Tätigkeiten in der Immobilienwirtschaft vor. Studierende erhalten ein vertieftes Verständnis über immobilienwirtschaftliche Zusammenhänge mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Investment, Finanzierung, Projektentwicklung und Management. Gerne beantworten Ihnen Prof. Dr. Michael Trübestein und Daniel Steffen vom IFZ Ihre Fragen.

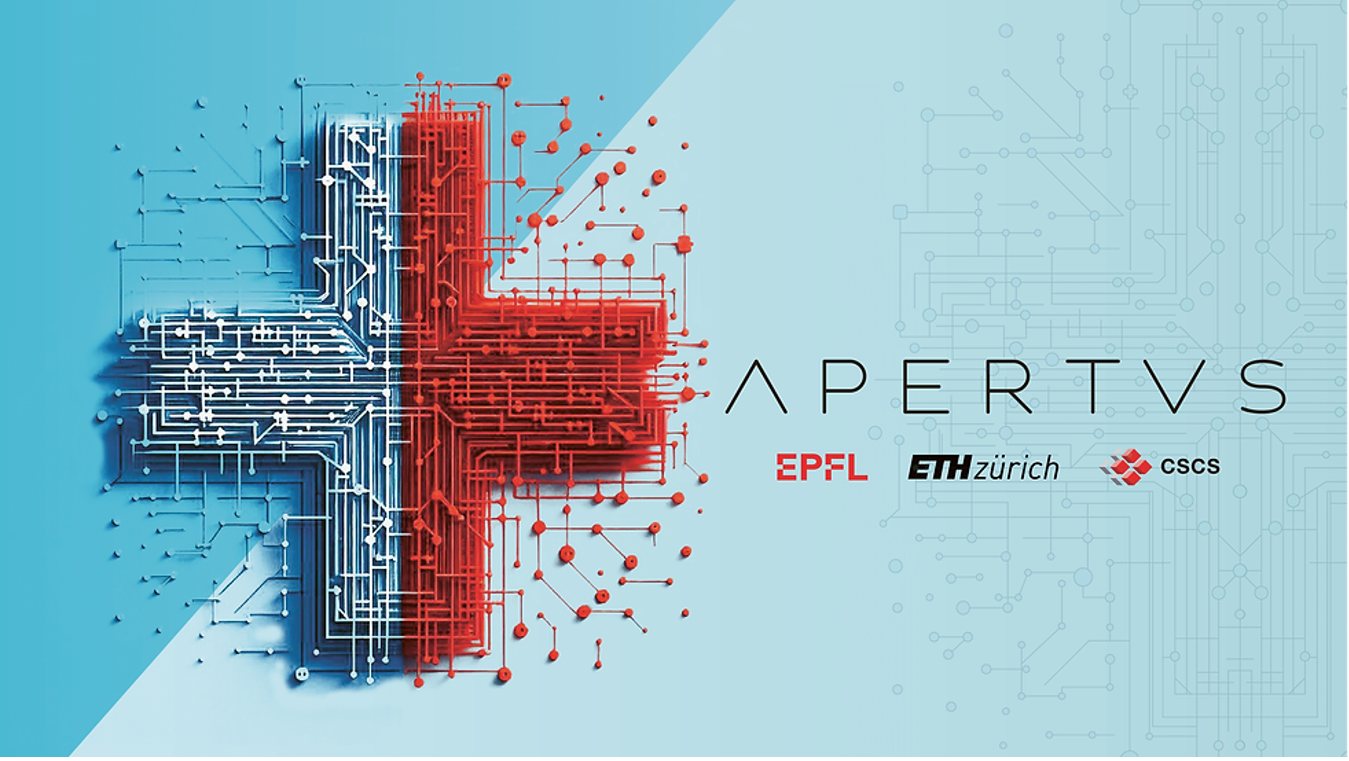

Kommentare
0 Kommentare
Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.