AGB-Recht: Ungewöhnliche Anwendung der Ungewöhnlichkeitsregel

Schon vor längerer Zeit haben wir hier auf dem Management & Law-Blog in einem Beitrag erläutert, was es im Zusammenhang mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder kurz AGB aus rechtlicher Sicht zu beachten gilt.
AGB bergen bekanntlich Risiken: Sie werden kundenseitig meist weder gelesen noch verstanden und gleichzeitig besteht kaum eine Möglichkeit, die AGB abzulehnen oder zu verhandeln. Deshalb gelten im Zusammenhang mit AGB gewisse Sonderregeln zum Schutz der schwächeren Partei. Eine davon ist die richterrechtlich entwickelte Ungewöhnlichkeitsregel. Sie greift dann, wenn AGB zwar in eine Geschäftsbeziehung einbezogen, aber nicht im Einzelnen zur Kenntnis genommen werden (sog. Globalübernahme). Nach dieser Regel sind ungewöhnliche Bestimmungen – also solche, welche die zustimmende Partei vernünftigerweise nicht erwarten muss – nichtig, es sei denn, es wurde speziell auf die betreffenden Klauseln hingewiesen (z.B. durch eine Hervorhebung mittels Fettdrucks).
Mit ebendieser Ungewöhnlichkeitsregel konnte sich das Bundesgericht nun diesen Sommer vertieft auseinandersetzen.
Die zugrundeliegende Streitigkeit: ein Softwareprojekt im B2B-Bereich und diverse Verträge
Dem Urteil des Bundesgerichts 4A_372/2022 vom 11. Juli 2023 lag eine 2019 eingegangene Geschäftsbeziehung zwischen einem IT-Unternehmen und einer Geschäftskundin rund um die Entwicklung, Bereitstellung und Wartung einer Softwarelösung zugrunde. Die Parteien hatten zu diesem Zweck mehrere Verträge abgeschlossen, die jeweils durch spezifische AGB des IT-Unternehmens ergänzt wurden.
Der Streit zwischen den beiden Unternehmen entbrannte, als die Kundin im Februar 2019 die Verträge wegen angeblicher Budgetüberschreitungen und Sicherheitslücken mit sofortiger Wirkung kündigte und Schadenersatz in Höhe von CHF 3 Mio. verlangte. Das IT-Unternehmen bestritt die Vorwürfe und verlangte im Gegenzug unter anderem die Bezahlung von CHF 90’000 für ausstehende Rechnungen sowie eine Konventionalstrafe von CHF 110’000.
Die beiden Forderungen des IT-Unternehmens stützten sich auf Art. 6 der AGB zu einem der abgeschlossenen Verträge, welcher zweierlei vorsah:
- erstens einen Prozess zur Beanstandung von Rechnungen, gemäss dem die Kundin, wenn sie mit einer Rechnung des IT-Unternehmens nicht einverstanden war, innerhalb von 30 Tagen mittels eingeschriebenen Briefs mit Rückschein eine hinreichend begründete Beschwerde erheben musste;
- und zweitens die Regelung, welche die Kundin zur Bezahlung einer Konventionalstrafe verpflichtete, wenn sie den Vertrag aus welchem Grund auch immer beendete, ohne dass dem IT-Unternehmen ein Verschulden zur Last gelegt werden konnte.
Die Kundin hatte die beiden Forderungen des IT-Unternehmens bestritten, jedoch die Gültigkeit der betreffenden AGB-Klausel nicht in Frage gestellt. Das Kantonsgericht des Kantons Fribourg als Erstinstanz hiess die Ansprüche des IT-Unternehmens auf ausstehende Rechnungen und auf Bezahlung der Konventionalstrafe gut.
Das bundesgerichtliches Urteil: AGB-Kontrolle auch im B2B-Setting und ohne entsprechendes Vorbringen
Anders als die Vorinstanz, die keine eigentliche AGB-Kontrolle durchgeführt hatte, prüfte das Bundesgericht die dargestellte Standardklausel im Lichte der Ungewöhnlichkeitsregel auf ihre Gültigkeit. In der Folge befand es beide Teile von Art. 6 der AGB für ungewöhnlich und wies daher die betreffenden Forderungen des IT-Unternehmens ab.
Dies überrascht in mehrfacher Hinsicht:
Erstens und vorab hätten die Parteien wohl nicht damit gerechnet, dass das Bundesgericht Art. 6 der AGB einer Ungewöhnlichkeitsprüfung unterzieht, war dies doch weder im vorinstanzlichen Verfahren noch in den Rechtsschriften an das Höchstgericht thematisiert worden. Nota bene auch die Kundin hatte nicht versucht, die betreffenden Bestimmungen unter Berufung auf die Ungewöhnlichkeitsregel zu Fall zu bringen. Das Bundesgericht nahm somit aus eigener Initiative eine Kontrolle des betreffenden Art. 6 vor, ohne dass dessen Ungültigkeit vorgebracht worden wäre. Prozessual ist dieses Vorgehen selbstredend nicht zu beanstanden, denn das Gericht ist in seiner rechtlichen Würdigung frei («iura novit curia») – faktisch erstaunt es aber gleichwohl ein wenig.
Zweitens hat das Bundesgericht die Ungewöhnlichkeitsregel vorliegend in einem Vertragsverhältnis angewendet, in dem sich zwei Unternehmen gegenüberstanden. Obschon eine Anwendung auf B2B-Settings – anders als etwa bei der AGB-Prüfung auf Missbräuchlichkeit nach Art. 8 UWG – bei der Ungewöhnlichkeitsregel nicht per se ausgeschlossen ist, ist dies bemerkenswert. Denn ihrem Sinn und Zweck nach ist diese Schutzregel auf Konstellationen ausgelegt, in denen es eine schwächere und geschäftsunerfahrene Partei vor ungewöhnlichen Klauseln zu schützen gilt, was typischerweise im Verhältnis zwischen Unternehmen und Konsumenten oder Arbeitnehmenden der Fall ist. Dies anerkannte auch das Bundesgericht im gegenständlichen Urteil, rief allerdings in Erinnerung, dass die Ungewöhnlichkeitsregel nicht auf Fälle beschränkt sei, in denen sich eine schwache und eine starke Partei gegenüberständen. Mithin genüge es etwa, dass die Vertragspartnerin des AGB-Verwenders mit einer bestimmten Branche nicht vertraut sei.
Und schliesslich ist auch die inhaltliche Beurteilung durch das Bundesgericht beachtlich, wonach beide Komponenten der betreffenden AGB-Klausel ungewöhnlich und daher nichtig seien. Im Wesentlichen führte das Gericht aus, dass hier stark in die Rechtsposition der Kundin eingriffen werde und diese mit den Gegebenheiten der IT-Branche nicht vertraut sei. Im vorliegenden Entscheid zeigt sich, dass die Hürde der Ungewöhnlichkeit nicht unerreichbar hoch ist, zumal das Bundesgericht ja die Umstände des spezifischen Einzelfalls zugrunde zu legen und entsprechend auch zu berücksichtigen hatte, dass die Kundin, obschon nicht aus der IT-Branche, so doch zumindest eine Geschäftskundin war. Mit Blick auf die Konventionalstrafe ist der vom Bundesgericht gewählte Weg über die Ungewöhnlichkeitsregel besonders bemerkenswert: Gemäss Art. 163 OR können Vertragsparteien Konventionalstrafen in beliebiger Höhe vereinbaren, wobei im Falle eines übermässig hohen Betrags eine gerichtliche Herabsetzung möglich ist. Das Bundesgericht hat sich vorliegend entschieden, die Konventionalstrafe nicht in Anwendung dieser auf genau solche Fälle zugeschnittenen Gesetzesbestimmung angemessen zu reduzieren, sondern sie vielmehr – aufgrund der Tatsache, dass sie nicht individuell, sondern in den AGB vereinbart wurde – für gänzlich nichtig zu erklären.
AGB als Bestandteil guten Vertragsmanagements – Bilden Sie sich weiter!
Der neue AGB-Bundesgerichtsentscheid unterstreicht einmal mehr: AGB können in der Praxis matchentscheidend sein und wollen sorgfältig aufgesetzt werden, und zwar nicht nur im B2C- sondern auch im B2B-Verhältnis.
Das umsichtige Formulieren und die adäquate Prozessgestaltung rund um den Einsatz der AGB sind dabei Grundvoraussetzung, damit die AGB dem reibungslosen Geschäftsbetrieb dienen und gleichzeitig rechtssicher und effektiv sind. Diese Aufgaben gehören zum betrieblichen Vertragsmanagement. Das charakteristische Zusammenspiel von rechtlichen sowie administrativ-prozessbezogenen Elementen macht das Vertragsmanagement zu einer ebenso spannenden wie wichtigen und komplexen Funktion im Unternehmen.
Kompetentes Vertragsmanagement erfordert dabei ein ganzes Set an Knowhow und Skills. Die Hochschule Luzern bietet mit dem CAS Vertragsmanagement ein interdisziplinäres Weiterbildungsprogramm, mit dem Fachpersonen aus den verschiedensten Bereichen genau dieses Knowhow und diese Skills vertiefen und zu einem integralen Kompetenzprofil im Contract Management ergänzen (Informationen zum CAS Vertragsmanagement in der Box).

CAS Vertragsmanagement
In drei praxisorientierten Modulen vermittelt das CAS Vertragsmanagement fundierte Kenntnisse in den Bereichen Recht und Vertragsgestaltung, Strategie und Verhandeln sowie Tools und Prozesse.
Die nächste Durchführung der Weiterbildung startet im Januar 2024 und dauert bis Juni 2024.

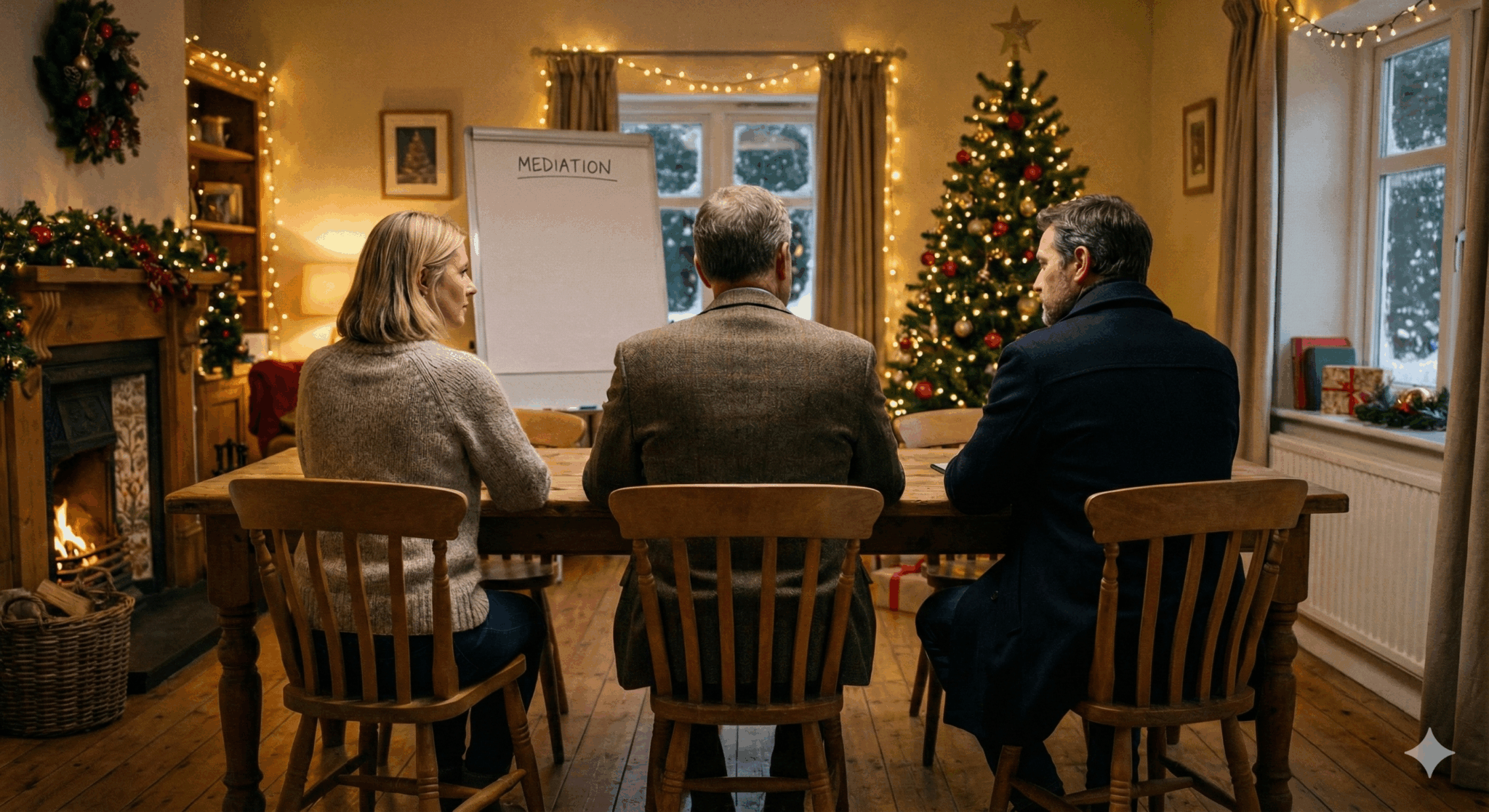


Kommentare
0 Kommentare
Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.