Asbest, Verjährung und Menschenrechte – ein schwieriges Verhältnis?

Seit 2020 hat die Schweiz ein neues Verjährungsrecht. Dieses sollte unter anderem die stossende Rechtslage bei Langzeitschäden etwa von Asbestopfern beseitigen, die häufig bereits verjährten, bevor sie erkennbar waren. Doch dies gelang nicht, wie ein neues Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gegen die Schweiz zeigt, das diese Woche unangefochten in Rechtskraft erwachsen ist. Der vorliegende Blogbeitrag zeigt die juristischen Hintergründe auf und erläutert, weshalb die EGMR-Verurteilung der Schweiz nicht überraschend kam.
In einem gesetzgeberischen Mammutprojekt wurde zwischen 2013 und 2018 das Schweizer Verjährungsrecht revidiert. Die Revision war nicht zuletzt durch das Bekanntwerden des Schicksals zahlreicher Asbestgeschädigter ausgelöst und befeuert worden: Bei ihnen hatte die Anwendung der alten Verjährungsregeln zur Folge, dass ihre Forderungen verjährt waren, lange bevor die asbestbedingte Krankheit überhaupt ausbrach. Diese stossende Rechtslage bei sogenannten Langzeitschäden, die bereits 2014 zu einer Verurteilung der Schweiz durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) führte (vgl. EGMR-Urteil vom 11. März 2014 i.S. Howald et al. vs. Schweiz, Nr. 52067/10 und 41072/11), sollte mit der Gesetzesrevision beseitigt werden. Doch dies gelang nicht: Knapp zehn Jahre nach dem Howald Moor-Fall verurteilte der EGMR die Schweiz im Februar 2024 erneut (vgl. EGMR-Urteil vom 13. Februar 2024 i.S. Jann-Zwicker und Jann vs. Schweiz, Nr. 4976/20). Dieses Urteil ist nun unangefochten in Rechtskraft erwachsen. Darin nimmt der EGMR auch auf das revidierte Verjährungsrecht Bezug und macht klar, dass die Gesetzesrevision die EMRK-Widrigkeit nicht ausgeräumt hat.
Die relevanten verjährungsrechtlichen Bestimmungen vor und nach der Gesetzesrevision
Bevor nachfolgend auf das neue EGMR-Urteil und dessen Folgen für die Schweiz eingegangen wird, ganz kurz zu den gesetzlichen Verjährungsregeln, die im vorliegenden Kontext relevant sind:
Das alte Verjährungsrecht sah vor, dass Ansprüche aus Deliktshaftung ein Jahr ab Kenntnis des Schadens und der Person des Ersatzpflichtigen (relative Verjährungsfrist) und jedenfalls zehn Jahre ab der schädigenden Handlung (absolute Verjährungsfrist) verjähren (Art. 60 Abs. 1 aOR). In der Verjährungsrevision wurde die relative Frist, welche beim subjektiven Wissensstand des Geschädigten ansetzt, von einem auf drei Jahre verlängert (Art. 60 Abs. 1 OR). Die absolute Verjährungsfrist wurde grundsätzlich bei zehn Jahren belassen (Art. 60 Abs. 1 OR), aber für Forderungen bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung auf zwanzig Jahre verlängert (Art. 60 Abs. 1bis OR). Nach wie vor markiert der Zeitpunkt der schädigenden Handlung bzw. deren Ende den Beginn der absoluten Verjährungsfrist.
Für eine umfassende Darstellung der Verjährungsrevision sei auf den Beitrag «Das neue Verjährungsrecht kommt – Referendumsfrist abgelaufen» verwiesen, der hier auf dem Management & Law-Blog im Oktober 2018 veröffentlicht wurde.
Typischer Asbest-Fall
Der Sachverhalt, welcher dem neusten EGMR-Urteil gegen die Schweiz zugrunde liegt, war noch unter altem Verjährungsrecht zu beurteilen. Es ging um einen typischen Asbest-Fall: Der 1953 geborene Marcel Jann war in seiner Kindheit während Jahren dem Einfluss von Asbest ausgesetzt, da er neben einem Fabrikgelände aufwuchs, auf dem das giftige Material täglich im Einsatz war. 32 Jahre später, im Herbst 2004, wurde bei ihm ein mutmasslich asbestinduzierter Tumor diagnostiziert, der 2006 zum Tod führte. In den Gerichtsverfahren, die Marcel Jann kurz vor seinem Tod eingeleitet hatte und die dann von seinen Erben fortgeführt wurden, wurden unter anderem deliktische Schadenersatzansprüche gegen das auf dem Fabrikgelände ansässige Bauunternehmen erhoben.
Sowohl vor den kantonalen Gerichten als auch vor Bundesgericht war der Schadenersatzklage kein Erfolg beschieden: Da die letzte geltend gemachte Asbestexposition im Jahr 1972 stattgefunden hatte, urteilten alle Instanzen in Anwendung von Art. 60 Abs. 1 aOR, dass allfällige Ansprüche bereits 1982 – d.h. 22 Jahre vor Ausbruch der Krankheit – verjährt gewesen waren (vgl. BGE 146 III 25).
Dagegen erhoben die klagenden Parteien unter Berufung auf Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) Beschwerde an den EGMR. Diese Bestimmung gewährt unter dem Titel «Recht auf ein faires Verfahren» jeder Person den Zugang zu einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das über die geltend gemachten Ansprüche in einem fairen Verfahren innert angemessener Frist und grundsätzlich öffentlich entscheidet.
Wie im Howald Moor-Fall machte auch die Klägerschaft in Sachen Jann-Zwicker primär geltend, dass die Anwendung von absoluten Verjährungsfristen bei Asbestschäden die Geltendmachung von Ersatzansprüchen verunmögliche, weil sich Erkrankungen wegen der langen Latenzzeiten regelmässig erst nach Fristablauf manifestierten. Dabei beriefen sich die Kläger auch auf das Howald Moor-Urteil des EGMR. In ihrer Stellungnahme führte die Schweiz aus, der EGMR habe im Howald Moor-Fall absolute Verjährungsfristen nicht generell als EMRK-widrig bezeichnet, denn sie würden ein berechtigtes Ziel verfolgen. Das Bundesgericht prüfe in jedem Einzelfall, ob die Anwendung der absoluten Verjährungsfristen verhältnismässig sei, und sei vorliegend zu Recht zum Ergebnis gelangt, dass dies mehr als 37 Jahre nach der behaupteten Pflichtverletzung der Fall sei.
EGMR-Urteil – zwar unter altem Verjährungsrecht, aber mit Gültigkeit auch nach der Revision
Der EGMR räumte in seinem Entscheid ein, dass das Recht auf Zugang zum Gericht nicht absolut sei. Beschränkungen seien zulässig, solange sie den Kerngehalt nicht antasteten, ein legitimes Ziel verfolgten und verhältnismässig seien, wobei den EMRK-Mitgliedstaaten ein gewisser Ermessensspielraum zukomme. Zwar verfolge die Schweiz mit ihren der Rechtssicherheit dienenden Verjährungsfristen ein durchaus berechtigtes Ziel. Jedoch verletze sie vorliegend den Zugang zum Recht, da sie einem Rechtssuchenden eine Verjährungsfrist zu einem Zeitpunkt entgegenhalte, in dem die erlittene Rechtsgutverletzung objektiv noch überhaupt nicht erkennbar sei. Wo wissenschaftlich erwiesen sei, dass eine Person nicht wissen könne, dass sie an einer bestimmten Krankheit leide, müsse diesem Umstand im Kontext der Verjährung Rechnung getragen werden.
Wie bereits das EGMR-Urteil in Sachen Howald Moor erging auch der Jann-Zwicker-Entscheid noch unter altem Verjährungsrecht. Allerdings ist den Ausführungen des EGMR deutlich zu entnehmen, dass das Urteil auch unter neuem Recht nicht anders ausgefallen wäre.
Angesichts der langen Latenzzeiten dürften asbestbedingte Ansprüche nicht nur bei Anwendung der früheren zehnjährigen (Art. 60 Abs. 1 aOR), sondern regelmässig auch der neuen zwanzigjährigen (Art. 60 Abs. 1bis OR) absoluten Verjährungsfrist verjährt sein. Problematisch ist gemäss EGMR mithin nicht die Verjährungsfrist an sich bzw. ob diese zehn, zwanzig, dreissig oder noch mehr Jahre beträgt, sondern vielmehr, dass der Beginn dieser Frist bei der Pflichtverletzung bzw. deren Ende ansetzt und dadurch EMRK-widrige Folgen zeitigt.
Spätschadensproblematik mit der Verjährungsrevision nicht beseitigt – was nun?
Die zweite Verurteilung der Schweiz im Jann-Zwicker-Fall war spätestens nach dem Howald Moor-Fall nicht überraschend. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund war der Gesetzgeber bestrebt, mit der Verjährungsrevision sowohl die Problematik der Langzeitschäden als auch die EMRK-Widrigkeit zu beheben. Die Voten der parlamentarischen Beratungen zeigen aber auch, dass bereits im Gesetzgebungsverfahren Zweifel daran bestanden, ob dies allein mit der blossen Verlängerung der absoluten Verjährungsfrist gelänge (vgl. zur parlamentarischen Debatte die Übersicht zum Geschäft 13.100). Dass der Gesetzgeber gleichwohl davon absah, das Problem an der Wurzel zu packen, dürfte das Ergebnis erfolgreicher Lobbying-Aktivitäten gewesen sein.
Nun steht definitiv fest, dass der Gesetzgeber mit der Verjährungsrevision die Spätschadensproblematik nicht wirklich gelöst hat und dass somit auch unter dem neuen Verjährungsrecht in analog gelagerten Fällen eine Verurteilung der Schweiz wegen Verletzung von Art. 6 Ziff. 1 EMRK droht. Wie ist damit umzugehen?
Die juristische Lehre sieht die Lösung des Problems verbreitet in einer Anwendung von Art. 134 Abs. 1 Ziff. 6 OR: Gemäss dieser Bestimmung beginnt die Verjährung nicht zu laufen bzw. steht still, solange eine Forderung aus objektiven Gründen vor keinem Gericht geltend gemacht werden kann. Das Bundesgericht hatte die Anwendung von Art. 134 Abs. 1 Ziff. 6 OR zwar bislang in Asbestfällen (unter altem Verjährungsrecht) verneint, da bei Spätschäden nur das subjektive Unwissen den Betroffenen daran hindere, ans Gericht zu gelangen (vgl. BGE 146 III 25, E. 3.1). Dies überzeugt allerdings gemäss hier vertretener Ansicht nicht, ist doch dort, wo eine Rechtsgutverletzung wissenschaftlich belegt nicht erkennbar ist, ein Hindernis von objektiver Natur anzunehmen.
In jedem Fall bleibt zu hoffen, dass im Lichte der nunmehr zwei EGMR-Urteile gegen die Schweiz zukünftig für gleichgelagerte Fälle eine sachgerechte Lösung gefunden werden kann – ob die Gerichte hierzu mittels einer EMKR-konformen Auslegung der geltenden Bestimmungen gelangen oder ob der Gesetzgeber aktiv werden muss, wird sich zeigen.
Weitere Informationen und Quellen:
EGMR-Urteile gegen die Schweiz:
- EGMR-Urteil vom 11. März 2014 i.S. Howald Moor et al. vs. Schweiz, Nr. 52067/10 und 41072/11
- BGE 136 II 187 (Howald Moor)
- EGMR-Urteil vom 13. Februar 2024 i.S. Jann-Zwicker und Jann vs. Schweiz, Nr. 4976/20
- BGE 146 III 25 (Jann-Zwicker)
- Widmer Lüchinger, C. (2024). Verjährung und Asbest: Die Schweiz wird erneut durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt. In: Jusletter vom 8. April 2024.
- Müller, C. (2024). Bis repetita placent: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt die Schweiz erneut wegen der absoluten Verjährung der Ansprüche von Asbestopfern. In: Jusletter vom 8. April 2024.
Verjährungsrevision:
- Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Verjährungsrecht) vom 29. November 2013
- Überblick über das Gesetzgebungsverfahren
- Krauskopf, F. & Märki, R. (2018). Wir haben ein neues Verjährungsrecht! In: Jusletter vom 2. Juli 2018.

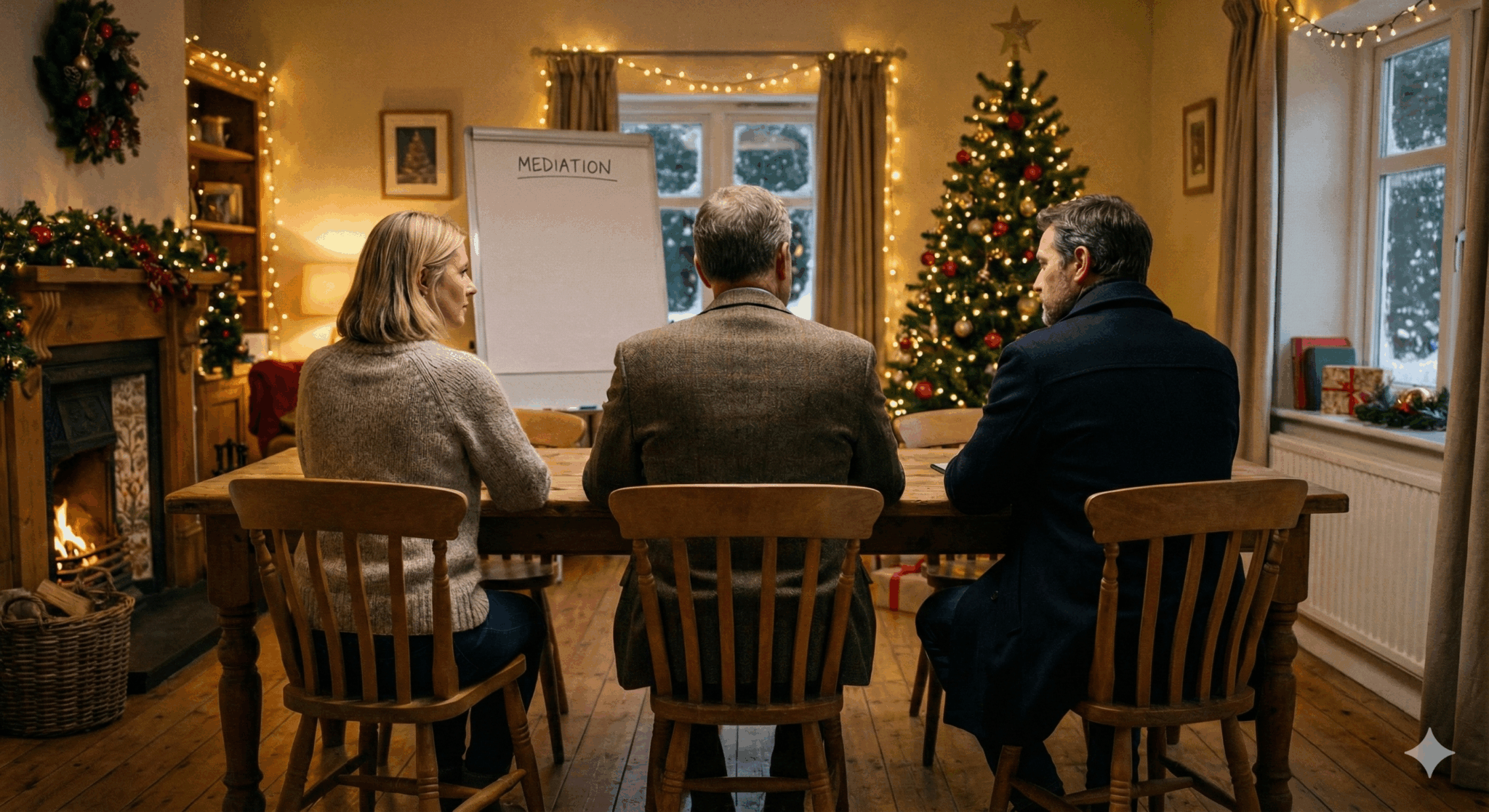


Kommentare
0 Kommentare
Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.