KI-Regulierung: Schweiz positioniert sich – oder doch nicht?
Lange wurde mit Spannung darauf gewartet, wie sich die Schweiz punkto Regulierung von künstlicher Intelligenz positioniert: Nun hat der Bundesrat am 12. Februar 2025 basierend auf einer umfassenden Auslegeordnung die Leitplanken zur KI-Regulierung festgelegt. Der vorliegende Blogbeitrag fasst die wichtigsten Punkte zusammen, ordnet die Stossrichtungen und die zugrundeliegenden Analysen ein und beantwortet die Frage, ob die Schweiz damit nun Stellung bezogen hat - oder doch nicht.
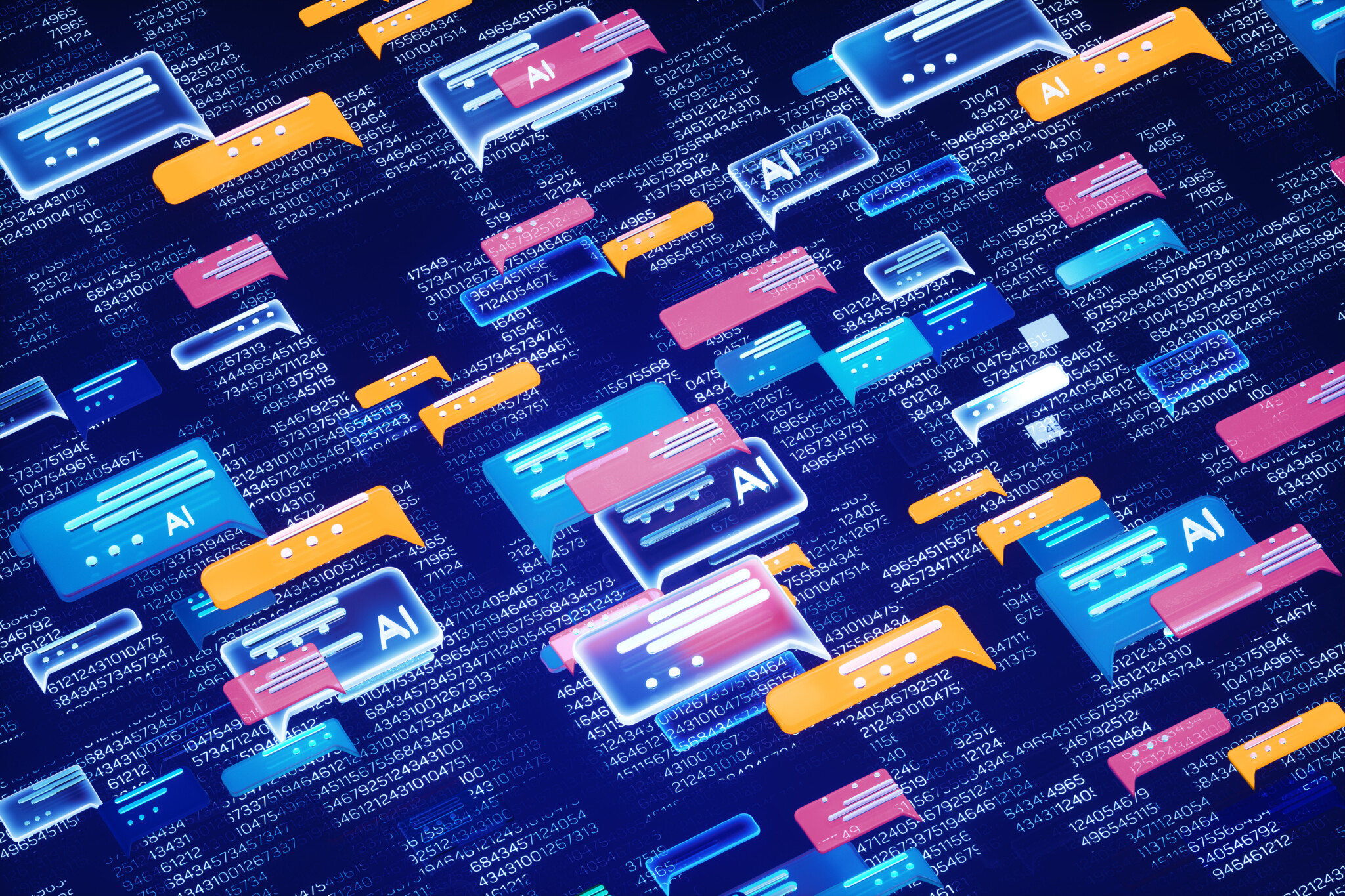
Seit dem flächendeckenden Aufkommen von künstlicher Intelligenz wird allenthalben diskutiert, ob und wie KI zu regulieren ist. Während etwa der Europarat mit der KI-Konvention und die EU mit dem AI Act bereits umfassende Regelwerke erlassen haben, besteht in der Schweiz bisher keine übergreifende Gesetzgebung spezifisch zu KI. Im November 2023 hat der Bundesrat in diesem Kontext das Bundesamt für Kommunikation BAKOM des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) sowie die Abteilung Europa beim Eidgenössischen Departement des Äusseren (EDA) beauftragt, eine Auslegeordnung zur möglichen Regulierung von KI zu erarbeiten. Bereits per Ende 2024 erwartet, wurde diese Auslegeordnung nun am 12. Februar 2025 vorgelegt.
Stossrichtungen der zukünftigen KI-Regulierung in der Schweiz
Basierend auf der Auslegeordnung hat der Bundesrat sogleich mehrere Grundsatzentscheide zur Stossrichtung der zukünftigen Schweizer KI-Regulierung gefällt, um die Ziele Stärkung des Innovationsstandorts Schweiz, Wahrung des Grundrechtsschutzes inklusive der Wirtschaftsfreiheit und Stärkung des Vertrauens der Bevölkerung in KI zu erreichen.
Schweiz ratifiziert KI-Konvention des Europarats
Erstens soll die KI-Konvention des Europarats ratifiziert werden. Diese ist nicht unmittelbar anwendbar und enthält keine direkten Verpflichtungen für Unternehmen oder Privatpersonen. Vielmehr richtet sie sich primär an den Staat, der entsprechende Ausführungsbestimmungen zu erlassen hat.
Prinzipienbasierte, technologie- und wettbewerbsneutrale, möglichst sektorielle Regulierung zur Umsetzung der KI-Konvention
Entsprechend hält der Bundesrat zweitens fest, dass dort, wo aufgrund der Ratifikation der KI-Konvention Gesetzesanpassungen erforderlich sind, diese möglichst sektoriell ausfallen sollen. Allgemeine, sektorübergreifende Regulierung soll nur in zentralen, grundrechtsrelevanten Bereichen erlassen werden. Als Beispiel wird hier der Datenschutz genannt. In jedem Fall soll die Regulierung prinzipienbasiert und technologieneutral erfolgen, bei Bedarf auch Ausnahmen zulassen und möglichst wettbewerbsneutral gestaltet sein.
Rechtlich nicht verbindliche Massnahmen flankieren die verbindliche KI-Regulierung
Flankiert werden soll die Ratifikation der KI-Konvention sowie die nötigen, punktuellen Gesetzesanpassungen drittens durch rechtlich nicht verbindliche Massnahmen zur Umsetzung der Konvention. Hier werden Selbstdeklarationsvereinbarungen und Branchenlösungen erwähnt. Aus dem resultierenden Zusammenspiel von rechtlich verbindlichen und unverbindlichen Massnahmen verspricht sich der Bundesrat einen sicheren Rechtsrahmen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der raschen Entwicklung und des Potenzials von KI.
Zur Umsetzung dieser grundsätzlichen Festlegungen soll bis Ende 2026 eine Vernehmlassungsvorlage zur Ratifikation der KI-Konvention vorbereitet werden, in der die notwendigen gesetzlichen Massnahmen, namentlich in den Bereichen Transparenz, Datenschutz, Nichtdiskriminierung und Aufsicht festgelegt werden. Gleichzeitig soll ein Plan für die weiteren, rechtlich nicht verbindlichen Massnahmen erarbeitet werden. Während bei der Vernehmlassungvorlage das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD im Lead ist und durch das UVEK und das EDA unterstützt wird, liegt die Federführung für die rechtlich nicht verbindlichen Massnahmen beim UVEK (unterstützt durch das EJPD, das EDA und das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF).
Auslegeordnung als Basis für den gewählten Regulierungsansatz
Die vom Bundesrat definierten Ansätze und Massnahmen basieren wesentlich auf der bereits erwähnten Auslegeordnung zur Regulierung von künstlicher Intelligenz, die das BAKOM und die Abteilung Europa des EDA vorgelegt haben. Entsprechend lohnt sich ein Blick in diese Grundlagen.
Die Auslegeordnung besteht aus einem 38-seitigen Bericht der auf drei Basisanalysen beruht:
- Auslegeordnung zur Regulierung von künstlicher Intelligenz – Bericht an den Bundesrat
- Rechtliche Analyse (Bundesamt für Justiz / EJPD): Untersuchung der Vorgaben der KI-Konvention und des AI Acts und der Auswirkungen auf die Schweiz und Analyse ausgewählte Aspekte inkl. Regulierungsbedarf unter Schweizer Recht (geistiges Eigentum, ausservertragliche Haftung, allgemeines Vertragsrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht)
- Sektorielle Analyse (BAKOM): Überblick zu aktuellen und geplanten sektoriellen Regulierungsaktivitäten
- Länderanalyse (BAKOM und EDA): Darstellung der regulatorischen Entwicklungen im KI-Kontext in 20 ausgewählten Ländern
Welches sind die wichtigsten Erkenntnisse der Auslegeordnung?
Keine einheitlichen Regulierungsansätze im internationalen Vergleich
Die Länderanalyse zeigt, dass in allen 20 analysierten Staaten ein Handlungsbedarf hinsichtlich der Regulierung von KI anerkannt zu sein scheint, dass aber weltweit verschiedene Regulierungsansätze bestehen, wobei kein Regulierungsansatz identifiziert werden könne, der sich klar durchsetze. Die meisten Länder verfügten im Gegensatz zur Schweiz zumindest über eine nationale Strategie oder einen Aktionsplan zu KI. Rechtsverbindliche Instrumente existierten aber abgesehen von der EU bisher nur in wenigen Ländern; die meisten Staaten befänden sich diesbezüglich derzeit in einer mehr oder weniger fortgeschrittenen Reflexions-, Verhandlungs- oder Entwicklungsphase. Hinsichtlich der Ausgestaltung lassen sich gemäss der Länderanalyse verschiedene Ansätze unterscheiden:
- Übergreifend vs. sektoriell: Bei der Frage, ob KI umfassend in einem übergreifenden Erlass (z.B. EU, Kanada, Brasilien, Südkorea) oder in mehreren sektoriellen Erlassen (z.B. Grossbritannien, Israel) reguliert werden soll, besteht keine einheitliche Tendenz.
- Staatlicher vs. privater Adressatenkreis: Während sich die Regulierung in den meisten Staaten sowohl an den öffentlichen wie den privaten Sektor richtet, beschränken sich einige Staaten (z.B. Australien, Japan, Singapur und die USA) für den privaten Sektor auf freiwillige Leitlinien.
- Umsetzung durch bestehende vs. neue Behörden: In einigen Staaten werden neue Umsetzungs- und Aufsichtsbehörden geschaffen, während in anderen bestehende Behörden mit dem KI-Thema betraut werden.
Rechtliche Analyse offenbart punktuellen Handlungsbedarf
Die rechtliche Analyse befasst sich erstens mit der KI-Konvention des Europarats und einer möglichen Umsetzung in der Schweiz. Die am 17. Mai 2024 unter Schweizer Vorsitz verabschiedete Konvention wurde bereits von der EU, Andorra, Georgien, Island, Israel, Moldau, Norwegen, San Marino, Grossbritannien und den USA unterzeichnet. Sie will sicherstellen, das der Einsatz von KI menschen- und grundrechtskonform und im Einklang mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erfolgt. Entsprechend richtet sie sich primär an die Staaten und gibt diesen durch die grundsätzlichen Prinzipien breiten Umsetzungsspielraum; private Akteure werden nur dort erfasst, wo eine direkte oder indirekte horizontale Wirkung der Grundrechte unter Privaten besteht. Jedenfalls aber identifiziert die rechtliche Analyse bei einer Ratifizierung der KI-Konvention durch die Schweiz Gesetzgebungsbedarf, vornehmlich in den Bereichen Transparenz und Kontrolle, sichere Innovation, Rechtsmittel, Verfahrensgarantien sowie Risiko- und Folgeabschätzung für KI-Systeme und Aufsichtsmechanismen. Insbesondere im Datenschutzbereich ortet die rechtliche Analyse zudem Koordinationsbedarf.
Zweitens betrachtet die rechtliche Analyse den AI Act der EU und dessen Auswirkungen auf die Schweiz. Es wird festgehalten, dass der AI Act zwar grundsätzlich nicht für die Schweiz gelte, aber aufgrund der extraterritorialen Wirkung für Schweizer Akteure trotzdem in vielfacher Hinsicht zentral sei. Sofern die Schweiz ihre Gesetzgebung dem AI Act annähern wollte, so die rechtliche Analyse, würde dies umfangreiche Anpassungen nach sich ziehen. Aber auch ohne eigentlichen gesetzgeberischen Nachvollzug, der laut der Auslegeordnung vielerorts kritisch gesehen würde, hat der AI Act praktische Auswirkungen auf die Schweiz und entsprechend ist insbesondere auch das Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (sog. MRA) relevant. Die Auslegeordnung kommt zum Schluss, dass die aktuellen Konformitätsbewertungsverfahren für KI im MRA nicht abgedeckt sind, sodass Schweizer Unternehmen für Produkte mi KI-Bestandteilen ab August 2027 ein zusätzliches Verfahren in der EU nach den Vorgaben des AI Acts durchlaufen und weitere Vorgaben erfüllen müssten. Sofern KI-Anwendungen nicht ins MRA integriert werden können, resultieren somit Doppelspurigkeiten und enorme Mehraufwände.
Drittens erörtert die rechtliche Analyse ausgewählte Rechtsgebiete mit sektorübergreifendem Charakter:
- Geistiges Eigentum: Im Bereich des geistigen Eigentums, insbesondere des Urheberrechts, anerkennt die rechtliche Analyse zwar, dass gewisse Fragen ungeklärt sind (vgl. dazu auch vertieft den Beitrag «ChatGPT & Co. – Was sagt das Urheberrecht?» hier auf dem Management & Law-Blog), hält jedoch fest, dass aktuell keine Revision geplant ist.
- Zivilrecht, insbesondere Haftpflichtrecht: Generell wird dem Zivilrecht aufgrund seiner offenen Generalklauseln in der rechtlichen Analyse attestiert, dass es den Gerichten ein ausreichendes Instrumentarium biete, um einzelfalladäquate Lösungen unter Berücksichtigung der technischen Fortschritte zu finden. Hinsichtlich haftungsrechtlicher Fragen (insbesondere selbstfahrende Autos und Drohnen) seien vertiefte Analysen unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen (auch in der EU) nötig und es wird auf einen generellen Modernisierungsbedarf im Produktehaftpflichtrecht hingewiesen.
- Arbeitsrecht: Im arbeitsrechtlichen Kontext wird punktueller gesetzgeberischer Handlungsbedarf etwa bei der Anwendung von KI im Bewerbungsverfahren anerkannt im Bereich Transparenz, Nichtdiskriminierung und Datenschutz. Jedoch wird in der Folge generisch auf die Entwicklung des allgemeinen rechtlichen Rahmens verwiesen.
- Strafrecht: Im strafrechtlichen Bereich wird wiederum ein grundsätzlich genügender Rahmen für eine technologieneutrale Anwendung gesehen, wobei sich praktische Abgrenzungsfragen (z.B. in Bezug auf die Verantwortlichkeit von KI-Herstellern und -Nutzern) stellen könnten. Auch hier erfolgt wiederum eine etwas allgemeine Relativierung, dass punktuelle Anpassungen (insbesondere auch unter Berücksichtigung internationaler Bestrebungen) zu evaluieren seien.
Kombination von sektorübergreifenden und sektorspezifischen Ansätzen sowie rechtlich unverbindlichen Massnahmen zielführend
Gemäss der sektoriellen Analyse stellt KI grundsätzlich alle Sektoren vor neue Herausforderungen insbesondere punkto Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Schutz der Privatsphäre und Datenschutz, Diskriminierung und Fairness sowie Cybersicherheit. Die Gewichtung der verschiedenen Faktoren sei jedoch sektoriell unterschiedlich. Die sektorielle Analyse kommt insgesamt zum Schluss, dass es sowohl gewisser sektorübergreifender Regulierungen als auch sektorspezifischer Ansätze bedürfe. Zudem befasst sich die sektorielle Analyse auch mit unverbindlichen (vornehmlich internationalen) Standards und Best Practices gerade auf technischer Ebene, welche sich derzeit stark entwickelten. Diese könnten eine wichtige Ergänzung und Präzisierung zu Regulierungen bieten.
Hat der Elefant eine Maus geboren?
Nach der Publikation der bundesrätlichen Grundsatzentscheide und der zugrundeliegenden Auslegeordnung füllte sich gestern mein – zugegebenermassen von Juristinnen und Juristen deutlich geprägter – LinkedIn-Feed mit Beiträgen rund um das Thema. Gleich mehrere Personen kamen wörtlich zum markanten Fazit, «der Elefant habe eine Maus geboren». Voneinander inspiriert oder einfach ein treffendes Resümee? Das Sprichwort dürfte dahingehend zutreffen, dass Ängste vor einem Schweizer AI Act, wie sie in den letzten Monaten bisweilen geäussert wurden, mit der bundesrätlichen Strategie zerstreut wurden. Gleichzeitig – und das wäre mit Blick auf das Sprichwort ebenfalls passend – bringen die Entscheidungen und die zugrundeliegende Auslegeordnung, die lange mit Spannung erwartet wurden, inhaltlich wenig grundlegend Neues und vor allen nichts Überraschendes. Dass beispielsweise die KI-Konvention des Europarats ratifiziert werden soll, erstaunt kaum, wurde sie doch unter Schweizer Vorsitz erarbeitet.
Der nun eingeschlagene Weg passt zum liberalen Ansatz der technologieneutralen und prinzipienbasierten Regulierung der Schweiz. In vielen Bereichen bleiben die Ausführungen – dem Charakter der Auslegeordnung entsprechend – noch sehr generisch und programmatisch. Ob der definierte Ansatz zielführend sein wird, hängt mit anderen Worten von der konkreten Umsetzung ab, die es erst noch im Einzelnen zu definieren gilt. Es bleibt also weiterhin spannend.
Kritische Stimmen gab es in meinem LinkedIn-Feed zum Timing – angesichts des Zeitplans, wonach «erst» bis Ende 2026 eine Vernehmlassungsvorlage für die nötigen Gesetzesanpassungen sowie ein Plan für die weiteren, rechtlich nicht verbindlichen Massnahmen erarbeitet werden solle, wünschte sich so manch einer «raschere Rechtssicherheit». Tatsächlich kommen einem knapp zwei Jahre in einem derart dynamischen Technologiebereich vor wie eine Ewigkeit. Auch kommt man nicht umhin, ein gewisses Spannungsfeld zu orten zwischen diesem Zeitplan und dem erklärten Ziel des Bundesrats, er wolle mit dem Zusammenspiel aus rechtlich verbindlichen und unverbindlichen Massnahmen auch «der raschen Entwicklung Rechnung tragen».
Allerdings gilt es auch festzuhalten, dass weder ein schneller Gesetzgebungsprozess noch der Erlass von Regeln per se ein Garant sind für Rechtssicherheit sind. So bleiben etwa in der EU auch mehr als ein halbes Jahr nach dem Erlass des AI Acts viele Aspekte unklar. Der umsichtige Ansatz, nur dort zu regulieren, wo mit der Anwendung des bestehenden Rechts keine adäquaten Lösungen erzielt werden, ist vor diesem Hintergrund jedenfalls zu begrüssen. In dieser Hinsicht bringt die nun vorliegende Auslegeordnung in einigen Bereichen eine gewisse, wenn auch nicht überall gleichermassen vertiefte und noch lange nicht abschliessende Klärung.

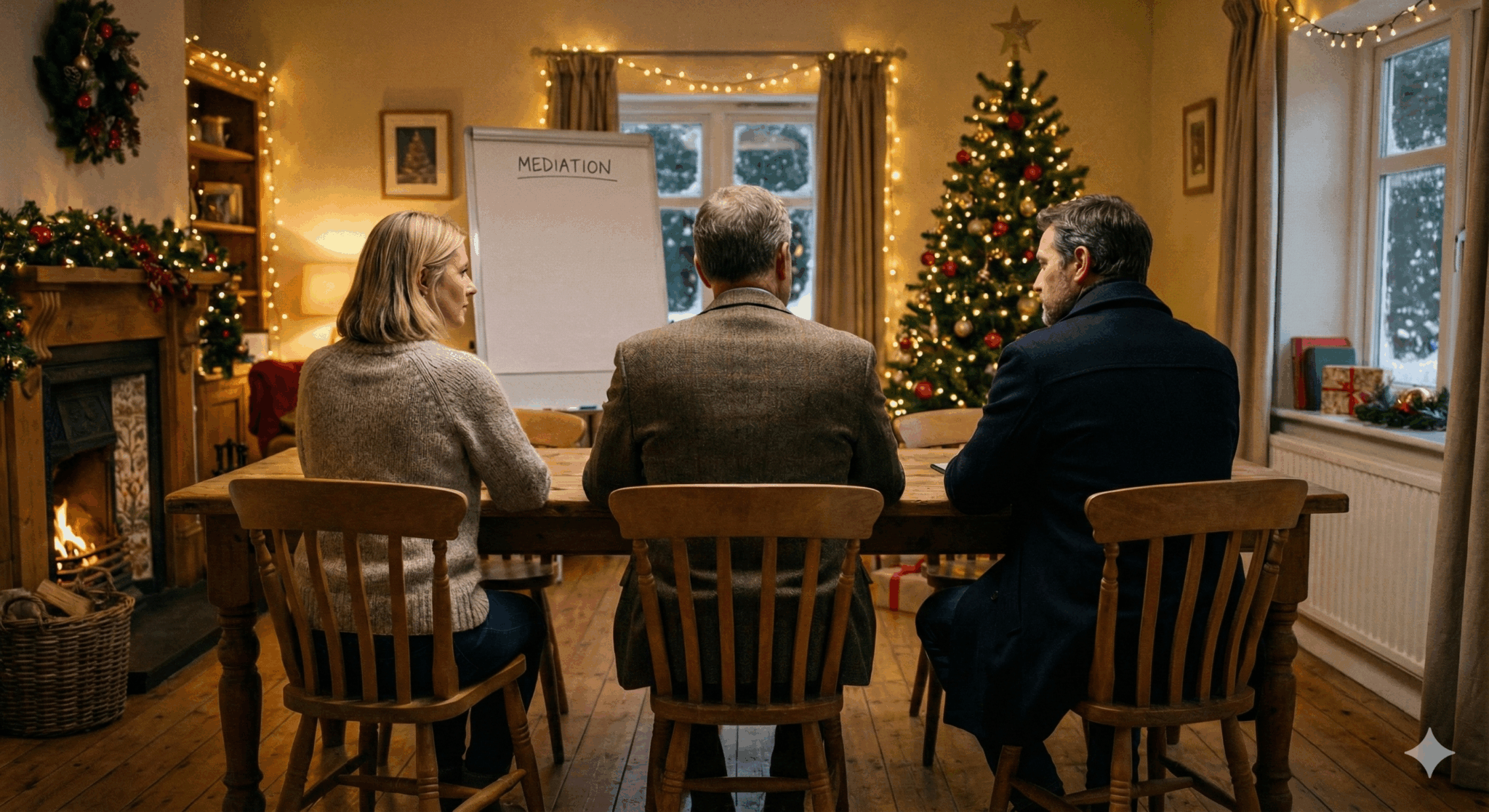


Kommentare
0 Kommentare
Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.