Spätdiagnose von ADHS bei Frauen – Ein unsichtbares Problem
Viele Frauen erhalten ihre AD(H)S-Diagnose erst im Erwachsenenalter, oft nach Jahren des Unverständnisses, der Vorurteile und der Selbstzweifel. Warum wird AD(H)S bei ihnen so spät erkannt? Und welche Folgen hat das für ihr Leben? Eine aktuelle Bachelorarbeit der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit zeigt, dass gesellschaftliche Rollenerwartungen, geschlechtsspezifische Unterschiede und der Gender Health Gap eine entscheidende Rolle spielen.

Viele Frauen erhalten ihre ADHS-Diagnose erst im Erwachsenenalter, oft nach Jahren des Unverständnisses, der Vorurteile und der Selbstzweifel. Warum wird ADHS bei ihnen so spät erkannt? Und welche Folgen hat das für ihr Leben? Eine aktuelle Bachelorarbeit der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit zeigt, dass gesellschaftliche Rollenerwartungen, geschlechtsspezifische Unterschiede und der Gender Health Gap eine entscheidende Rolle spielen.
Die Studentinnen Ramona Rüegg und Maryrose Maeder haben sich in ihrer Bachelorarbeit «Auswirkungen einer späten AD(H)S-Diagnose auf das Leben von Frauen» mit den Herausforderungen und den Gründen für die späte Erkennung der Störung befasst. Ihr Interesse entstand aus der Erkenntnis, dass viele Betroffene jahrelang mit Unsicherheiten, Fehldiagnosen und gesellschaftlichen Vorurteilen kämpfen. Mit ihrer Arbeit wollen sie nicht nur auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei AD(H)S aufmerksam machen, sondern auch zu einer Sensibilisierung und gezielteren Unterstützung beitragen.
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung) und ADS (Aufmerksamkeits-defizitsyndrom) sind zwei Formen derselben neurologischen Störung, unterscheiden sich jedoch in ihrer Ausprägung. Das „H“ für Hyperaktivität wird in Klammern gesetzt, weil nicht alle Betroffenen hyperaktiv sind.:
- ADHS (mit Hyperaktivität): Betroffene zeigen ausgeprägte Unruhe, Impulsivität und starke Ablenkbarkeit. Sie sind oft sehr aktiv, haben Schwierigkeiten, stillzusitzen, und handeln oft impulsiv.
- ADS (ohne Hyperaktivität): Hier steht vor allem eine ausgeprägte Unaufmerksamkeit im Vordergrund. Betroffene wirken verträumt, vergesslich und haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, sind aber nicht hyperaktiv oder impulsiv.
Warum wird AD(H)S bei Frauen später erkannt?
Gesellschaftliche Erwartungen – das Bild des «braven» Mädchens
Frauen werden häufiger als ruhig, organisiert, verträumt und einfühlsam wahrgenommen. Diese gesellschaftlichen Zuschreibungen beeinflussen den Blick auf ihre Verhaltensweisen. Während impulsive oder hyperaktive Jungen in der Schule schnell auffallen, werden ähnliche Probleme bei Mädchen oft als «Unkonzentriertheit» oder «Sensibilität» abgetan. Ihre tatsächlichen AD(H)S-Symptome werden nicht als solche erkannt, sondern als Charakterzüge oder gar Schwächen fehlinterpretiert.
Internalisierte Symptome – AD(H)S ohne Zappeln
Ein weiteres Problem ist die Art und Weise, wie sich AD(H)S bei vielen Frauen äussert. Während Jungen oft durch hyperaktives Verhalten und Impulsivität auffallen, kämpfen Frauen eher mit innerer Unruhe, Perfektionismus und übermässiger Anpassung. Statt offensichtlicher Verhaltensauffälligkeiten entwickeln sie Strategien, um ihre Schwierigkeiten zu überdecken. Dies erfolgt meist durch übermässige Selbstkontrolle, sozial angepasste Bewältigungsmechanismen oder ständige Selbstkritik. Diese «stille» Form von AD(H)S bleibt im Alltag häufig unerkannt, wodurch eine späte Diagnose begünstigt wird.
Fehlende geschlechtersensible Diagnostik (Gender Health Gap)
Ein zentrales Problem ist, dass viele Diagnosekriterien auf männliche Symptome ausgerichtet sind. Standardisierte Tests und Fragebögen basieren hauptsächlich auf Forschung mit Männern und Jungen, die eher unter äusserlich sichtbarer Hyperaktivität leiden. Frauen mit AD(H)S entsprechen häufig nicht diesem Bild und erhalten stattdessen oft falsche Diagnosen wie Depressionen, Angststörungen oder Persönlichkeitsstörungen. Dadurch wird ihnen jahrelang die richtige Unterstützung verwehrt.
Gender Health Gap bezeichnet die ungleiche medizinische Versorgung von Frauen und Männern. Da Forschung, Medikamente und Diagnosen lange auf männliche Patienten ausgerichtet waren, werden Behandlungsmethoden oft nicht an die spezifischen Bedürfnisse von Frauen angepasst.
Die Folgen einer späten Diagnose
Wer erst spät eine AD(H)S-Diagnose erhält, hat oft schon viele Herausforderungen erlebt:
Psychische Belastung durch negative Bewältigungsstrategien
Viele Frauen entwickeln unbewusst Strategien, um mit unerkanntem AD(H)S umzugehen. Dabei neigen sie jedoch oft zu schädlichen Bewältigungsmustern wie Selbstzweifeln und übermäßigem Perfektionismus. Der Druck extremer Selbstkontrolle führte bei den in der Bachelorarbeit befragten Frauen zu komorbiden Störungen wie Essstörungen, Angststörungen oder Depressionen – Diagnosen, die meist gestellt wurden, bevor AD(H)S erkannt wurde.
Stigmatisierung und gesellschaftlicher Druck
Frauen mit AD(H)S passen oft nicht in das Bild der «geordneten, verlässlichen und gut organisierten» Frau. Ihre Schwierigkeiten mit Struktur, Aufmerksamkeit oder Impulsivität werden nicht als neurologisch bedingt erkannt, sondern als Charakterschwächen fehlinterpretiert. Sie gelten als chaotisch, unzuverlässig oder emotional instabil. Labels, die den inneren Druck und das Gefühl des Andersseins verstärken und zu Selbststigmatisierung führen.
Schwierigkeiten im Berufs- und Alltagsleben
AD(H)S beeinflusst oft grundlegende Fähigkeiten wie Organisation, Zeitmanagement und soziale Interaktion. Frauen mit unerkannter AD(H)S kämpfen damit, Termine einzuhalten, konzentriert zu arbeiten oder zwischenmenschliche Beziehungen stabil zu halten, oft ohne zu verstehen, warum sie immer wieder an denselben Herausforderungen scheitern. Dies kann zu beruflichen Schwierigkeiten, wiederkehrenden Konflikten im sozialen Umfeld oder einem Gefühl der Überforderung im Alltag führen.
Was muss sich ändern?
Die Ergebnisse der Bachelorarbeit machen deutlich: Es braucht dringend eine geschlechtersensible Herangehensweise in der Diagnostik und Therapie von AD(H)S.
Mehr Aufklärung und Sensibilisierung
AD(H)S äussert sich bei Frauen anders als bei Männern. Doch dieses Wissen fehlt vielen Fachpersonen, wodurch Betroffene lange unerkannt bleiben. Ärzt:innen, Lehrkräfte und Sozialarbeitende müssen stärker über die geschlechtsspezifischen Symptome informiert werden.
Frühzeitige Diagnosen ermöglichen
Während hyperaktive Jungen oft schnell auffallen, zeigen viele Mädchen eher nach innen gerichtete Symptome. Diese Anzeichen und Symptome müssen bereits in der Schule, bei Ärzt:innen und in der psychosozialen Arbeit stärker berücksichtigt werden, um Fehldiagnosen oder jahrelange Unsicherheit zu vermeiden.
«Die Soziale Arbeit kann in der Unterstützung eine wichtige Rolle spielen – sei es in der Beratung, in Schulen oder in psychosozialen Hilfsangeboten.»
Gezielte Unterstützung für betroffene Frauen
Eine späte AD(H)S-Diagnose bedeutet oft, dass Betroffene bereits einen langen Leidensweg hinter sich haben. Umso wichtiger ist es, dass sie nach der Diagnose die richtige Unterstützung erhalten. Individuelle Beratung, auf Frauen zugeschnittene Therapieformen und konkrete Hilfen für den Alltag, etwa durch die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Anpassung positiver Bewältigungsstrategien, können ihre Lebensqualität erheblich verbessern.
Die Soziale Arbeit kann hier eine wichtige Rolle spielen – sei es in der Beratung, in Schulen oder in psychosozialen Hilfsangeboten. Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht es Frauen, sich selbst besser zu verstehen, ihre Herausforderungen gezielt anzugehen und ihr Leben nachhaltig zu verbessern.
FAQ: Häufige Fragen zum Thema AHDS und ADS
- Worin unterscheiden sich ADHS und ADS genau?
ADHS umfasst Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität, während ADS vor allem durch Unaufmerksamkeit und innere Unruhe ohne äussere Hyperaktivität gekennzeichnet ist. - Warum wird ADHS bei Frauen oft spät erkannt?
Symptome bei Frauen äussern sich häufig subtiler, werden von gesellschaftlichen Rollenbildern überdeckt und die Diagnostik orientiert sich oft an männlichen Verhaltensmustern. - Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es nach einer späten Diagnose?
Betroffene können von individueller Beratung, gezielter Therapie, Selbsthilfestrategien und Unterstützung im Alltag profitieren, um Organisation, Aufmerksamkeit und Selbstwert zu stärken.
Von: Ramona Rüegg und Maryrose Maeder
Bild: Adobe Photoshop
Veröffentlicht: 22. April 2025
Interessierst du dich für ein Studium in Sozialer Arbeit?
Wir unterstützen dich, Menschen in allen Lebenslagen zu begleiten und fördern deine Urteilsbildung sowie deine Fähigkeit, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Werde Teil eines werteorientierten Studiums, das auf gesellschaftlichen Wandel abzielt und die Teilhabe aller ermöglicht.
Jetzt eine Infoveranstaltung zum Bachelor besuchen.
Neuer Bachelor in Sozialer Arbeit neue Konzepte und Innovation
Jetzt anmelden: CAS Prävention und Gesundheitsförderung Grundlagen
Im CAS erhalten Teilnehmende einen Überblick über die Vielfalt von Gesundheitsförderung und Prävention. Das CAS-Programm hat zum Ziel, den Kontext und die Begriffe der professionellen Praxis zu klären und die Teilnehmenden in verschiedene Strategien, Methoden und Handlungsfelder der Prävention und Gesundheitsförderung einzuführen.
Infoveranstaltung: 1. Juli 2025
Programmstart: 9. Oktober 2025
Anmeldung: Hier anmelden

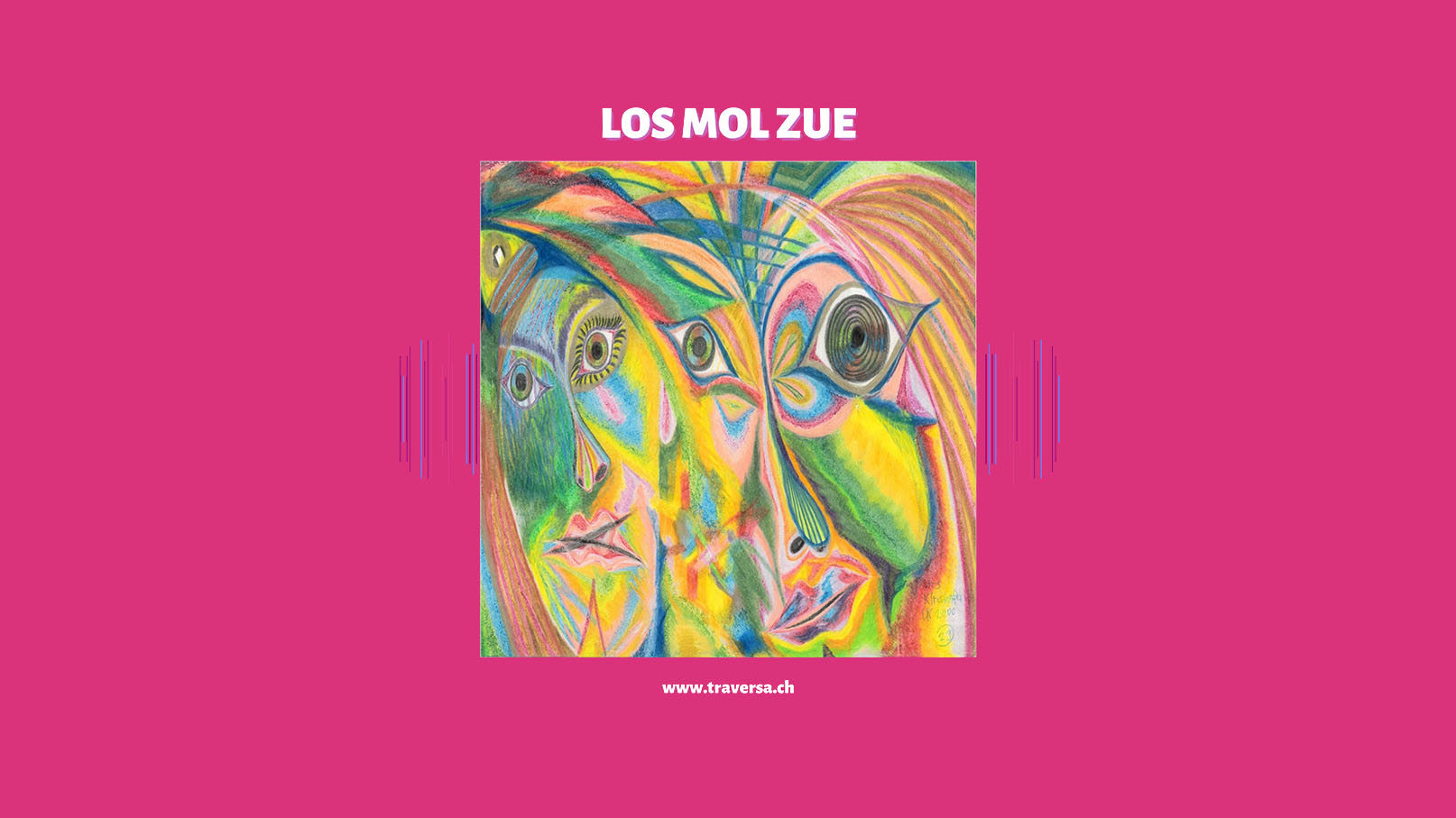

Kommentare
0 Kommentare
Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.