Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung,
«Partizipation ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern Ausdruck einer funktionierenden Demokratie»
Kürzlich erschien das Buch «Soziokulturelle Entwicklung zwischen Forschung und Praxis», herausgegeben von Stephanie Weiss und Dominic Zimmermann. Im Interview zeigen die beiden Fachpersonen, wie man in partizipativen Prozessen auch die «leiseren» Stimmen berücksichtigt und warum soziokulturelle Expertise heute nötiger ist als je zuvor.

1. «Soziokultur verbindet», so der Claim zum Bachelor in Sozialer Arbeit mit Vertiefungsrichtung Soziokultur an der HSLU. Wie ist das eigentlich zu verstehen?
Dominic Zimmermann (DZ): Am besten fragt man die, die den Slogan erfunden haben (schmunzelt). Was unter Soziokultur oder Soziokultureller Animation genau verstanden wird, variiert nämlich zwischen Berufsgruppen, Ländern und Sprachregionen. Deshalb haben wir auch versucht, in unserem Buch zu definieren, was wir darunter verstehen: Es geht darum, die gesellschaftliche und zwischenmenschliche Kohäsion zu stärken. Darauf zielt auch dieser Claim ab – die Soziokulturelle Animation als Brückenbauerin zwischen gesellschaftlichen Schichten oder Gruppierungen. Das zentralste Mittel ist Partizipation. Dabei geht es aber immer auch um Visionen, wie eine demokratische Gesellschaft aussehen kann, und um die Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe. Das heisst, dass es bei Soziokultureller Animation immer auch um Gerechtigkeit und um ethische Fragen geht, also um eine ganze Programmatik und nicht nur um Methoden.
2. Was zeichnet soziokulturelle Entwicklungsprozesse aus?
Stephanie Weiss (SW): Was sie von anderen Vorgehensweisen unterscheidet, ist eine Grundhaltung, die den Einbezug von relevanten Gruppen und ihre Sichtweise prinzipiell berücksichtigt. Die geeignete Methodik entsteht jeweils aus dem Prozess und aus der jeweiligen sozialräumlichen Situation. Idealerweise sind die Betroffenen nicht einfach nur Partizipierende, sondern von Anfang an in den Prozess oder sogar in die Definition des Prozessdesigns integriert.
DZ: Was ich herausheben möchte, ist die Sensibilität für den (sozialen und räumlichen) Kontext. Der Einbezug der Betroffenen von Beginn weg ist das zentrale Mittel, um den Kontext aus deren Sicht zu verstehen und die unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen.
3. Im Vorwort der neuen Publikation heisst es sinngemäss: «Oft stehen nach dem Projektabschluss für eine nachträgliche Reflexion und Aufbereitung keine Ressourcen mehr zur Verfügung. Dieses Buch soll dazu beitragen, diese Lücke anhand von dokumentierten Erfahrungen zu schliessen.» War das also der der ursprüngliche Gedanke dahinter?
SW: Ja, es war unser Anliegen, dieses Wissen festzuhalten. Wir wollten zudem das Spektrum der anwendungsorientierten Forschung am Institut für Soziokulturelle Entwicklung (ISE) sichtbar machen. Statt nur Projektbeschriebe aufzulisten, haben wir spezifische und doch typische Herangehensweisen und Handlungsverständnisse herausgearbeitet. Die Beiträge umfassen zudem verschiedene räumliche Ebenen – die Beispiele reichen von städtischen bis hin zu alpinen Gemeinden und von nationalen bis hin zu internationalen Kontexten – und verbinden Fragestellungen aus allen drei Kompetenzzentren des ISE, Stadt- und Regionalentwicklung, Zivilgesellschaft und Teilhabe und International Community Development.
4. Dabei wird deutlich, dass viele gesellschaftliche Herausforderungen potenzielle Handlungsfelder von Soziokultur sind. Könnt Ihr das anhand von ein paar Beispielen vertiefen?
DZ: Das Kapitel von Alex Willener dokumentiert zum Beispiel einen jahrelangen Partizipationsprozess in Hasliberg, einer Berggemeinde im Berner Oberland, mit unterschiedlichsten Akteur:innen. Häufig sind soziokulturelle Profis in eher urbanen Gemeinden unterwegs – deshalb finde ich es schön, Projekte aus dem ländlichen Raum dabeizuhaben. Die gesellschaftlichen Herausforderungen sind ja auch in Berggemeinden enorm, man denke an die alternde Wohnbevölkerung oder das Spannungsfeld Zweitwohnungen.
SW: Auch im ländlichen Kontext angesiedelt ist zum Beispiel die BestAndermatt-Studie von Beatrice Durrer Eggerschwiler, Caroline Näther und Mario Störkle [die Langzeit-Studie untersuchte die Transformation der Gemeinde Andermatt der letzten Jahre hin zum internationalen Tourismusresort, Anm. der Redaktion]. Der Beitrag von Rebekka Ehret im Kanton Uri zeigt ebenfalls, dass soziokulturelle Ansätze umso wichtiger sind in Gemeinden mit wenig Erfahrung, solche Prozessbegleitungen zu initiieren. Sie verfügen in der Regel auch nicht über die nötigen Ressourcen.
Wir haben auch Beispiele aus dem urbanen Raum, wie das Projekt von Simone Gretler Heusser zum Basler Wettsteinquartier. Dort hat sie partizipativ herausgearbeitet, welche Strukturen und Bedürfnisse von Senior:innen zu berücksichtigen sind, um daraus Empfehlungen für altersgerechte Quartiersangebote abzuleiten. Die Bilder in unserer Publikation stammen übrigens von diesem Projekt.
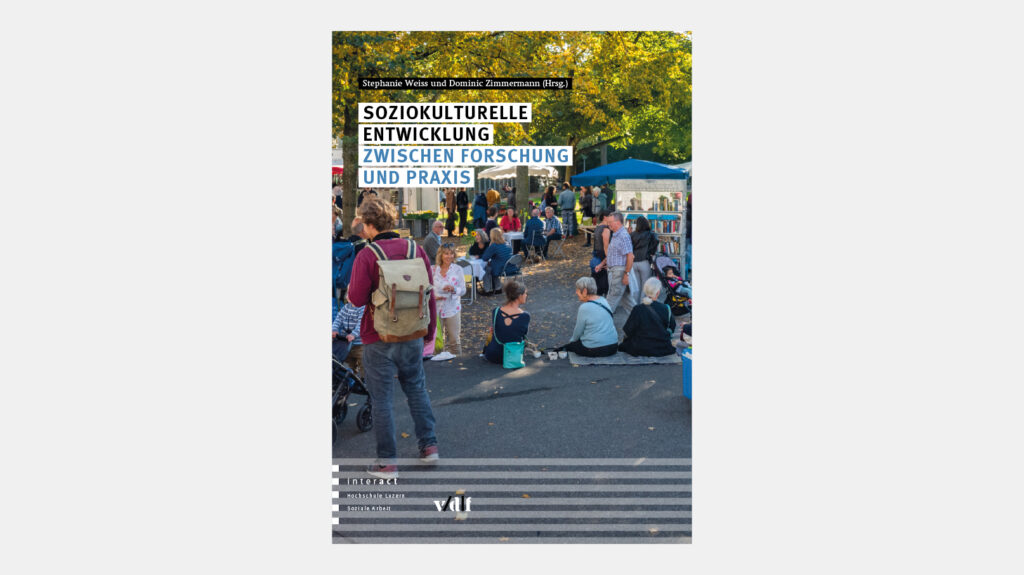
5. Das Ziel des Buches ist ja, methodische Herangehensweisen zu veranschaulichen. Aufgefallen ist mir ein Kapitel über den Einsatz von Augmented Reality in der Raumplanung.
SW: Augmented Reality kann ein niederschwelliges Instrument zur Simulation von Raumgestaltung sein. Also zeigen, was es konkret heisst, wenn jetzt so und so verdichtet wird oder wie diese Parkgestaltung oder jener Begegnungsort gedacht sind. Das Kapitel mit den Karten ist auch spannend.
DZ: Genau, das wäre dann eher eine klassische Art der Visualisierung. Karten sind neben architektonischen Visualisierungen wahrscheinlich das beliebteste Mittel, um räumliche Entwicklungen darzustellen – auch in partizipativen Prozessen. Damit sind allerdings Herausforderungen verbunden. Zum Beispiel die Vielstimmigkeit: Wie vorgehen, wenn Leute ihre Perspektive auf einer Karte eingezeichnet haben und man anschliessend alle – auch die «leiseren» Stimmen – in der Synthese berücksichtigen will? Heute gibt es zum Glück geografische Informationssysteme mit unterschiedlichen ein- und ausblendbaren Ebenen. So geht auch Information aus frühen Schritten nicht verloren. Das schafft Transparenz und ist mit Gerechtigkeitserwägungen vereinbar.
SW: Alle Autor:innen geben übrigens Empfehlungen ab für eine erfolgreiche Übertragung der Methoden auf andere Zusammenhänge. Sie reflektieren, welches methodische Vorgehen im jeweiligen Fall sinnvoll war und wie unterschiedliche Anspruchsgruppen einbezogen wurden.
6. Wie bereits erwähnt wurde, ist das ISE sehr aktiv im Bereich der Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung. Warum profitieren insbesondere Raumplanungsprojekte von soziokulturellen Ansätzen und welche Raumverständnisse treffen hier aufeinander?
DZ: Vielen Raumplanungsbüros fehlt das Know-how bei der Realisierung partizipativer Prozesse, dem Umgang mit sozial vielfältigen Kontexten und der Gestaltung sozial nachhaltiger Projekte. Ich stelle bei Raumplaner:innen jedoch ein grosses Interesse an solchen Fragen fest: Es gibt also eine Nachfrage für Fachpersonen der soziokulturellen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.
SW: Im Buch wurden deshalb auch Fragen formuliert, die genau auf diese Expertise abzielen. Relevant ist hier das Verständnis von Sozialraum. Wir verstehen Raum – also eine Siedlung, ein Quartier, eine Region oder auch ein internationales Projekt – immer mehrdimensional. Dabei geht es längst nicht nur um gebaute Strukturen, sondern vor allem darum, wie sich die darin lebenden Menschen ihre Alltagsräume aneignen können.
7. Wie kommt es, dass das Buch in die Abschnitte «Beteiligen», «Vermitteln» und «Verstetigen» unterteilt ist?
SW: Sie entsprechen Prozessaspekten, die bei allen Projekten vorkommen und sich unter dem Begriff der Partizipation summieren lassen. Beim Aspekt «Beteiligen» fragen wir uns, wen wir involvieren wollen, wer unsere Anspruchsgruppen sind und wer unsere Auftraggeber:innen. Beim «Vermitteln» geht es darum, wie die Prozessergebnisse oder Sachverhalte den Akteur:innen vermittelt werden. Übersetzungsleistungen und Moderationskompetenzen sind hier zentral. Das «Verstetigen» von Projekten ist dann der wichtigste Aspekt: Dies kann gelingen, indem das Projekt beispielsweise in selbsttragende Strukturen übergeben wird.
DZ: Zum Aspekt des Vermittelns möchte ich noch ergänzen, dass damit nicht nur das Vermitteln von Informationen gemeint ist, sondern auch das Vermitteln zwischen unterschiedlichen Perspektiven.
8. Lässt sich abschliessend sagen, dass Soziokultur ein wichtiger Faktor ist für positive gesellschaftliche Veränderungen? Fördert sie nebst der Lebensqualität der Menschen gar die Demokratisierung?
SW: Soziokultur ist absolut notwendig, wenn man sich die aktuelle demokratische Situation in Europa und anderswo anschaut. Gesellschaftliche Veränderung kann nur stattfinden, wenn alle betroffenen Gruppen daran beteiligt sind und diese mitgestalten können. Partizipation ist nicht einfach nur Mittel zum Zweck, sondern Ausdruck einer funktionierenden Demokratie.
DZ: Im Hinblick auf die aktuell zahlreichen Spaltungstendenzen scheint mir die Funktion der Soziokultur als Brückenbauerin und Demokratieförderin ebenfalls notwendig und gerechtfertigt.
Von: Mirjam Kilchmann
Bilder: Mirjam Kilchmann, Charles Habib
Veröffentlicht am: 5. Juni 2024
Über das neue Buch
«Soziokulturelle Entwicklung zwischen Forschung und Praxis» wurde von Stephanie Weiss und Dominic Zimmermann unter Mitarbeit von Franziska Städler und Kathrin Leitner herausgegeben. Im Buch werden neun Projekte vorgestellt, in denen es um die Stadt- und Quartierentwicklung, den öffentlichen Raum und das Zusammenleben als Zivilgesellschaft geht. Der Fokus liegt dabei auf der sozialräumlichen und soziokulturellen Herangehensweise: Anhand der Prozessaspekte «Beteiligen», «Vermitteln» und «Verstetigen» werden die angewandten Methoden veranschaulicht und reflektiert. Der Sammelband ist im interact-Verlag erschienen.

Dr. Stephanie Weiss
Die Kulturwissenschaftlerin und Sozialgeographin ist Dozentin und Projektleiterin am Institut für Soziokulturelle Entwicklung sowie Co-Leiterin des Bachelors neue Konzepte und Innovation. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung, Partizipation und lokale Demokratie sowie soziale Nachhaltigkeit in der räumlichen Entwicklung.

Dominic Zimmermann
Der Gesellschaftswissenschafter ist Senior Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziokulturelle Entwicklung. Seine Forschungsschwerpunkte sind Jugendpartizipation, kulturelle Teilhabe, Gestaltung öffentlicher Räume sowie Musik und Tanz in der soziokulturellen Animation.
Interessieren Sie sich für unsere Aus- und Weiterbildungen?
?? Besuchen Sie unsere Info-Veranstaltungen!
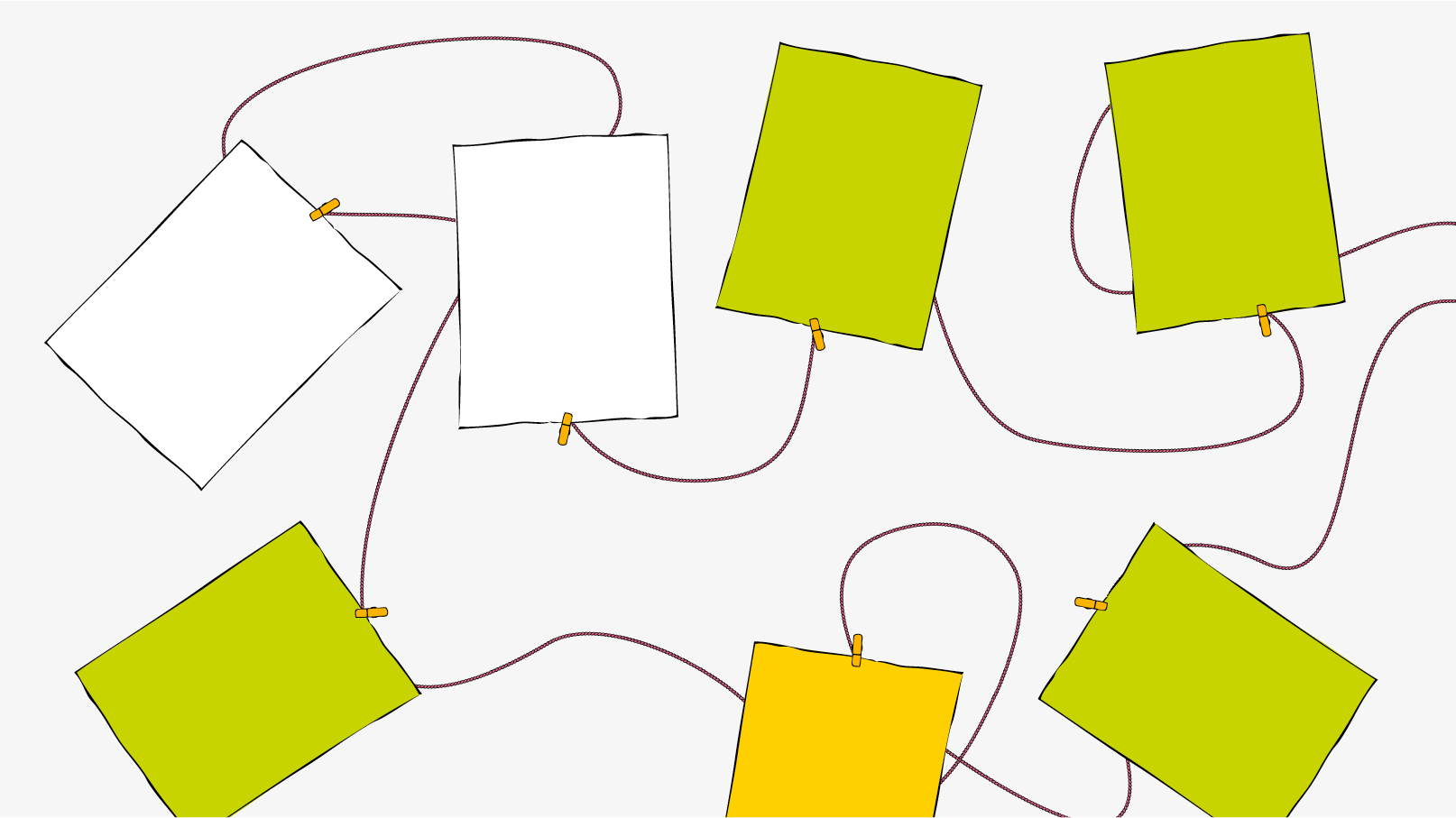


Kommentare
0 Kommentare
Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.