24. Juni 2024
Auf den Spuren der Bilanzfälschung
Der Unterschied zwischen legaler Bilanzkosmetik und strafbarer Bilanzfälschung führt in der Praxis regelmässig zu Fragen und Abgrenzungsschwierigkeiten. Die Teilnehmenden des Seminars «Bilanzfälschung» erhielten einen umfassenden Einblick in die verschiedenen relevanten Aspekte und untersuchten, ab wann solche Handlungen strafbar sind und wie man den Verfehlungen auf die Spur kommt.

Von Susanne Grau und Dr. Claudia V. Brunner
Am 17. Juni 2024 begrüssten die Seminarleiterinnen Susanne Grau und Dr. Claudia V. Brunner auf dem Campus Zug-Rotkreuz einen hochinteressierten Kreis an Teilnehmenden aus Verwaltung und Privatwirtschaft. Gemeinsam mit den Expertinnen und Experten widmeten sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln den Aspekten der Bilanzfälschung, um sich künftig bestmöglich im Kampf gegen solche Delikte einzubringen.
Die strafrechtliche Relevanz von Bilanzmanipulationen
Susanne Grau, Dozentin und Projektleiterin am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern, eröffnete das Seminar mit ihrem Vortrag zum Thema «Bilanzfälschung aus Sicht des Strafrechts». Zunächst gab sie ein Überblick über die für die Buchführung und Rechnungslegung relevanten Straftatbestände, bevor sie ausführlicher auf die Voraussetzungen der Urkundenfälschung respektive Falschbeurkundung einging, da das Verständnis dieser Aspekte für die Bekämpfung der Bilanzfälschungen von grosser praktischer Bedeutung ist. Welche Elemente gehören aus strafrechtlicher Sicht zur Bilanzurkunde und ab wann liegt eine Täuschung über ihren Inhalt vor? Diese Fragen wurden anhand der relevanten Rechnungslegungsvorschriften, der Rechtsprechung sowie von Untersuchungsberichten zu Bilanzskandalen erörtert. Abschliessend fasste sie anhand eines Schemas zusammen, wie buchhalterische Praktiken verhältnismässig einfach strafrechtlich beurteilt werden können, und illustrierte dies anhand der Fälle Erb und Postauto.
Bilanzfälschung aus der Perspektive der Revisionsstelle
In seinem Referat «Bilanzmanipulation aus Sicht der Revisionsstelle» führte Marc Arnet, Mandatsleiter Wirtschaftsprüfung bei Mattig-Suter und Partner sowie Absolvent des MAS Economic Crime Investigation, die Teilnehmenden in die Perspektiven und Erfahrungen der Revisionsstellen ein. Zunächst beleuchtete er den Fall Wirecard, bei welchem ein Viertel der Bilanzsumme, beziehungsweise 1.9 Milliarden Euro «frei erfunden» war. Anschliessend analysierte er den Fall der deutschen «Flowtex»-Gruppe, die mit nicht existierenden Spezialbohrmaschinen ein fiktives Warenlager aufbaute und ein Schneeballsystem betrieb. Ausserdem wies er auf den aktuellen Fall Benko hin, dessen Firmengruppe durch ihre unübersichtliche Struktur und das Fehlen einer konsolidierten Bilanz auffällt. Im Anschluss an die Fallbesprechungen thematisierte er die «mehrfache Erwartungslücke» bei den Revisionsstellen. Dabei betonte er, dass die Mehrheit der Schweizer Unternehmen keine Revisionsstelle hat, da nur wenige überhaupt prüfungspflichtig sind. Selbst bei den Unternehmen mit einer Revisionsstelle werden die Auswirkungen deliktischer Handlungen auf den Abschluss nur geprüft, wenn sie der ordentlichen Revision unterliegen, was lediglich bei rund 2% aller Schweizer Unternehmen der Fall ist.
Bilanzkosmetik
Nach dem gemeinsamen Mittagessen widmete sich Marco Passardi, Professor für Accounting am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern, dem Thema der erlaubten Bilanzpolitik. Zunächst erläuterte er, wie sich Fehler in der Rechnungslegung auswirken und wie Unternehmen damit umgehen sollten, insbesondere, da dies im Obligationenrecht nicht explizit geregelt ist. Fehler haben nicht zwingendermassen einen deliktischen Hintergrund, können aber im Einzelfall signifikante Auswirkungen auf Bilanz und Erfolgsrechnung haben, so zum Beispiel bei der Einzel- und Gruppenbewertung. Anhand anschaulicher Fallbeispiele führte er die Teilnehmenden durch das Thema und ermutigte sie zum Mitdenken und Mitmachen. Sobald Fehler die Aussagekraft der Jahresrechnung deutlich beeinträchtigen, müssen sie als qualitativ wesentlich betrachtet werden. Anhand von Fallbeispielen zu Rückstellungen und Abschreibungen, wie beispielsweise dem Wechsel der Abschreibungsmethode von degressiv zu linear, erläuterte er, was verboten und erlaubt ist. Abschliessend wies er auf den sogenannten JET-Test beziehungsweise das «Journal-Entry-Testing» hin, eine Analysemethode, mit der auffällige Abweichungen wie Buchungen mit runden Beträgen oder zu ungewöhnlichen Zeitpunkten festgestellt werden können.
Mit technischen Hilfsmitteln der Bilanzfälschung auf der Spur
Den Abschluss des Seminartages gestalteten Matthias Kiener, Partner sowie Head of Forensic, und Varad Srinivasan, Manager, bei Forvis Mazars. Matthias Kiener führte zunächst in das Thema Datenanalyse und technische Mittel ein und legte dar, wo im Unternehmen Anomalien beziehungsweise Betrugsrisiken auftreten können. Anschliessend präsentierte Varad Srinivasan praktische Anwendungsbeispiele. So wird beispielsweise beim «Channel Stuffing» kurz vor Ende des Geschäftsjahres der Verkaufskanal aufgebläht, indem Warenverkäufe verbucht werden, obwohl die Kunden die Waren bei Nichtgebrauch oder Nichtverwendung gegen Gutschrift wieder zurückschicken können. Solche Verkäufe lassen sich mittels Datenanalyse grafisch darstellen und erkennen. Ein weiteres Beispiel zeigte, wie Unternehmen feststellen können, ob Mitarbeitende ihre Spesen korrekt abrechnen respektive ob es «Ausreisser», wie beispielsweise überhöhte oder nicht gerechtfertigte Spesen, gibt. In einem Fallbeispiel aus einer Weinkellerei wurde durch die Analyse der Badge-Nutzung nachgewiesen, dass der überhöhte Lagerbestand an Wein wahrscheinlich auf den übermässigen Besuch des Weinkellers durch den entlassenen Geschäftsführer zurückzuführen war. Im letzten Beispiel wurden die Finanzierungs- und Fortschrittsdaten von Projekten analysiert, um ungewöhnliche Konstellationen aufzudecken, wie zum Beispiel eine 100-prozentigen Finanzierung bei einer Fertigstellung von lediglich fünf Prozent.
Erweiterung des Fachwissens
Die angeregten Diskussionen während den Referaten, in den Pausen und während dem gemeinsamen Mittagessen zeigten, dass das Thema Bilanzfälschung nach wie vor von grosser Wichtigkeit ist. Das Wissen rund um Bilanzfälschung kann im Rahmen des Fachbereichs Wirtschaftskriminalistik durch den Besuch des CAS Economic Crime Investigation vertieft werden. Das Weiterbildungsprogramm kann in einem Zeitraum von sieben Jahren mit einem Master vervollständigt werden. Das Seminar Bilanzfälschung wird auch im Jahr 2025 wieder angeboten.
Autorin: Susanne Grau

Autorin: Dr. Claudia V. Brunner



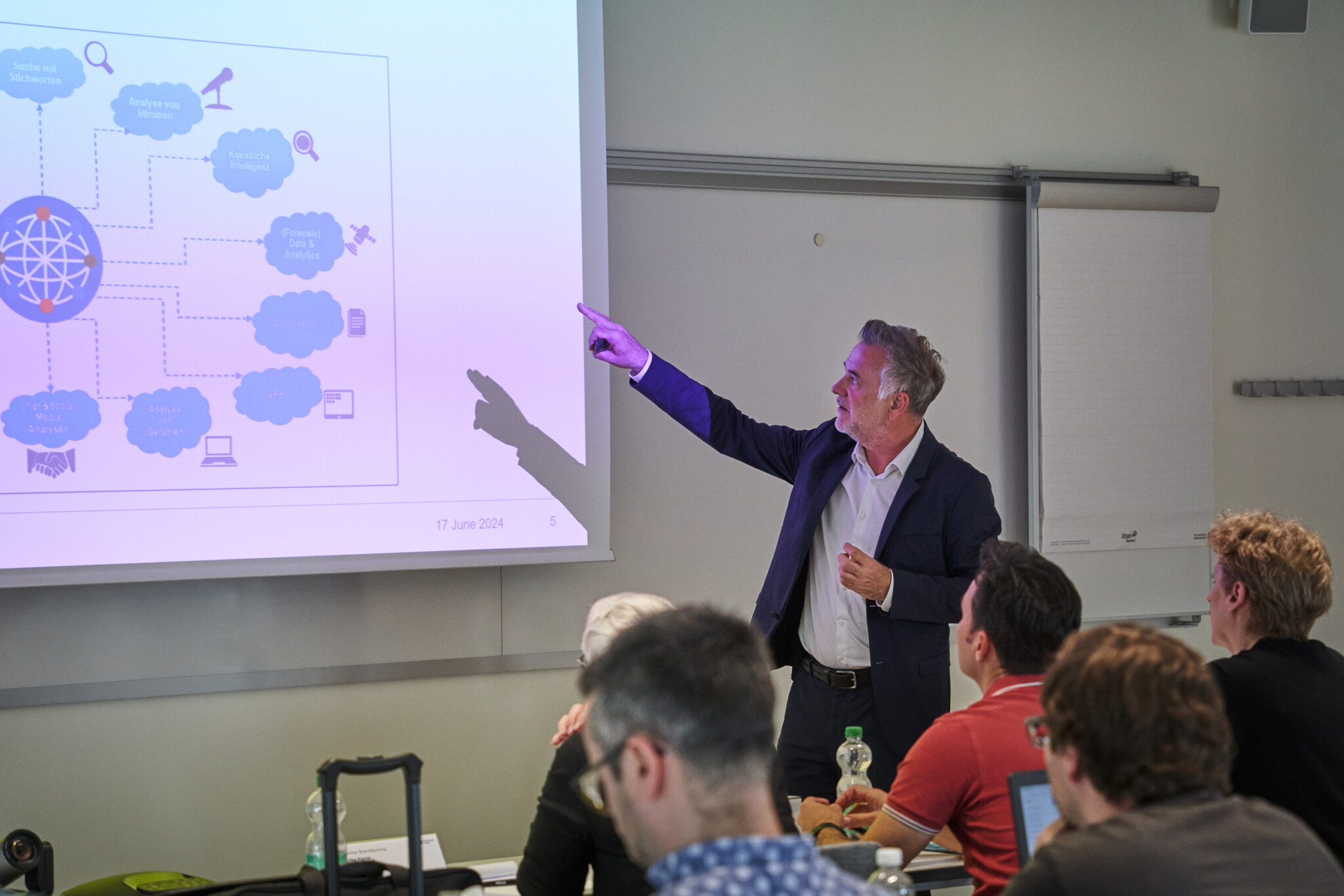





Kommentare
0 Kommentare
Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.