Neurodivergente Studierende: Was mich mein Bruder über die Lehre lehrt

Neurodivergenz betrifft nicht nur Einzelne – sie fordert uns alle heraus. Unser Dozent Jan Carlos Janke erklärt, wie ihn sein Bruder mit Asperger-Syndrom dazu gebracht hat, Lehre neu zu denken. Was neurodivergenten Studierenden hilft, nützt oft allen. Es verändert den Blick auf Struktur, Sprache und Beziehung im Unterricht.
Von Jan Carlos Janke
Ich schreibe diesen Beitrag nicht als Experte für Neurodiversität. Ich schreibe ihn als Bruder. Und als Dozent.
An der Hochschule Luzern sprechen wir Dozierenden oft über Inhalte, Methoden und Technologien. Über Tools, Prüfungsformate und Lernziele. Doch manchmal bringt mich mein Bruder dazu, diese Strukturen mit ganz anderen Augen zu sehen. Denn seine Wahrnehmung ist anders. Nicht falsch – nur nicht mittig.
Mein Bruder ist neurodivergent. Vor kurzem hat er ein Studium abgeschlossen, worauf ich sehr stolz bin. Er hat das Asperger-Syndrom, eine Unterform von Autismus.
Was das konkret bedeutet, lässt sich diagnostisch beschreiben. Doch viel wichtiger ist, wie es sich anfühlt, mit ihm zu sprechen, zu leben, zu lernen. Seine Welt ist manchmal klarer, kompromissloser, ehrlicher – aber auch verletzlicher gegenüber dem, was viele von uns «normal» nennen.
Neurodivergente Menschen brauchen andere Formen von Struktur, Sprache und Orientierung. Das Wissen darum hat mich als Dozent verändert.
Unterschiede in der Wahrnehmung: Was ist Neurodiversität – und was Neurodivergenz?
Neurodiversität beschreibt die natürliche Vielfalt menschlicher Gehirne – und damit die unterschiedlichen Arten zu denken, zu lernen, zu fühlen und die Welt wahrzunehmen. Sie umfasst sowohl neurotypische als auch neurodivergente Menschen.
Neurodivergent sind Menschen, deren neurologische Verarbeitung sich deutlich von der Mehrheit unterscheidet. Dazu zählen zum Beispiel Autismus, ADHS, Dyskalkulie, Legasthenie oder das Asperger-Syndrom (Letzteres gilt heute als Teil des Autismus-Spektrums). Diese Unterschiede bringen im Alltag manchmal Herausforderungen mit sich – aber auch besondere Stärken.
Hochschulen, die neurodivergente Studierende gezielt unterstützen, fördern nicht nur Chancengleichheit, sondern auch Innovation. Denn wer Lehre inklusiv denkt, denkt weiter.
Neurodivergente Menschen lernen anders. Sie nehmen Reize anders wahr. Sie brauchen andere Formen von Struktur, von Sprache, von Orientierung. Und das Wissen darum hat mich als Dozent verändert.
Klar kommunizieren – statt zwischen den Zeilen
Durch meinen Bruder habe ich verstanden: Unsere Lehre basiert oft auf unausgesprochenen Erwartungen. Auf Zwischentönen, impliziten Abläufen, ungeschriebenen Regeln. Doch was passiert, wenn Studierende diese Zwischentöne nicht hören? Wenn das Curriculum keine Spur bietet, der sie folgen können?
Dann helfen kleine Dinge. Klar strukturierte Sitzungen. Sichtbare Agenda. Explizite Sprache. Pausen, die tatsächlich Pausen sind. Und Dozierende, die nicht alles voraussetzen – sondern bewusst anschlussfähig bleiben.
Inklusive Hochschullehre: Online-Reihe bietet Impulse
Die Online-Reihe «Lehre im Fokus» der Hochschule bietet neue Impulse für eine inklusive, neurodiversitätssensible Hochschullehre – kompakt in einer Stunde über Mittag. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die Frage, wie Lehre barrierefrei und chancengerecht gestaltet werden kann. Im Zentrum stehen konkrete Herausforderungen und praxistaugliche Lösungen wie Nachteilsausgleich und didaktische Werkzeuge.
Reinschauen und dazulernen! Unser Gastautor und Dozent Jan Carlos Janke wurde durch dieses Angebot sensibilisiert: «David Loher führt diese Reihe mit grossem Engagement. Er hat mich sehr inspiriert und mein Bewusstsein für meine Rolle als Dozent geschärft.» Schauen auch Sie vorbei: Hinweise auf kommende Veranstaltungen finden Sie in diesem Newsletter.
David Loher
Fachspezialist Hochschuldidaktik
Ich bin überzeugt: Wer für neurodivergente Studierende gut unterrichtet, unterrichtet am Ende für alle besser. Denn klare Sprache, logische Struktur, didaktische Transparenz – das nützt nicht nur «anderen» Studierenden. Es macht Lehre insgesamt menschlicher, zugänglicher und wirksamer.
Neurodiversitätssensible Lehre senkt nicht den Standard – sie denkt ihn neu. Von der Mitte aus, in alle Richtungen. Die Lernziele bleiben gleich, doch der Weg dorthin wird vielfältiger. Entscheidend ist nicht, wie jemand lernt, sondern dass das Ziel erreicht wird.
Impulse für die Hochschule: Entwicklung bewusster fördern
An der Hochschule Luzern arbeiten wir an innovativen Lehrformaten, an praxisnaher Weiterbildung und an strategischer Exzellenz. Doch der Kern bleibt: Wie schaffen wir Räume, in denen Lernen gelingt – für alle?
Die Strategie der Hochschule Luzern formuliert mit dem Leitsatz «Wir schaffen Wirkung» eine klare Vision: Bildung soll nicht nur technisch anschlussfähig sein – sondern individuell, kooperativ und sinnstiftend. Es geht um mehr als Inhalte: Es geht um Beziehung, um Zugehörigkeit und um die Ermöglichung von Entwicklung.
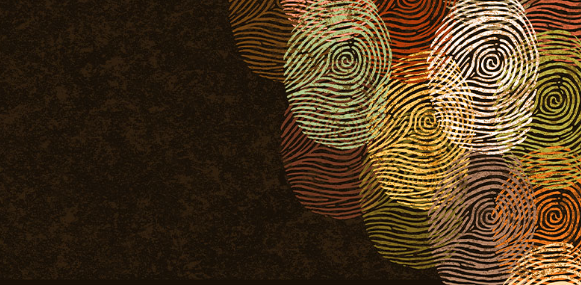
Diese Massnahmen sind kein Sonderweg – sie machen Lehre für alle zugänglicher.
Was heisst das konkret? Ich achte als Dozent noch bewusster darauf, Lehrumgebungen zu gestalten, die neurodivergenten Studierenden Orientierung und Sicherheit bieten – und dadurch letztlich allen Lernenden zugutekommen:
- Klare Strukturen schaffen – schriftlich, verbindlich, transparent.
Jede Lerneinheit folgt einem wiedererkennbaren Ablauf, der vorab kommuniziert wird – inklusive Zeitrahmen, Zielen und Übergängen. - PowerPoint-Folien und Materialienfrühzeitig bereitstellen.
So können sich Studierende in ihrem eigenen Tempo vorbereiten und fühlen sich im Unterricht sicherer. - Erwartungen explizit und schriftlich kommunizieren.
Prüfungsformate, Leistungsanforderungen und Deadlines werden nachvollziehbar, damit niemand auf implizite Regeln angewiesen ist. - Gruppen nicht spontan bilden lassen, sondern aktiv zuteilen.
Das reduziert sozialen Stress und ermöglicht ausgewogenere Gruppendynamiken. - Routinen etablieren und vorhersehbare Abläufe ermöglichen.
So wird der Lernraum zu einem stabilen, verlässlichen Rahmen – auch in digitalen Settings. - Nicht zu viel Selbstständigkeit voraussetzen, sondern unterstützend anleiten.
Komplexe Aufgaben werden in Zwischenschritte gegliedert – mit klarer Navigation und offenem Feedback-Kanal. - Flexibilität ermöglichen, wo individuelle Belastung sichtbar wird.
Das kann bedeuten, Abgabefristen zu verschieben oder alternative Prüfungsformen anzubieten – ohne die Standards zu senken.
Inklusion als Beitrag für alle Studierenden
Diese Massnahmen sind kein Sonderweg – sie machen Lehre für alle zugänglicher und transparenter. Gerade der strategische Schwerpunkt «Inspirierende Bildungsumgebung» spricht von Zugänglichkeit, Diversität und neuen didaktischen Ansätzen – genau hier verortet sich das Thema Neurodiversität. Nicht als Zusatz, sondern als Teil einer inklusiven, zukunftsfähigen Lehre.
Gesetzliche Grundlagen zur Inklusion: Der Auftrag der Hochschule
Der gesetzliche Auftrag zur Inklusion an Hochschulen ist unter anderem in den folgenden rechtlichen Grundlagen festgehalten:
Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (HFKG): Nennt Gleichstellung und soziale Durchlässigkeit explizit als Ziele des Schweizer Hochschulsystems.
UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), Artikel 24 – Bildung: Verlangt ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen.
Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) Verpflichtet öffentliche Einrichtungen – darunter auch Hochschulen –, Barrieren abzubauen und die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen zu fördern.
Im Rahmen meines Engagements im Themenfeld Digital Business & Innovation (DB&I) erlebe ich täglich, wie wichtig dieser Perspektivenwechsel ist: Wir gestalten Lehr- und Lernformate, die technologiegetrieben sind – aber gleichzeitig menschlich, anschlussfähig und praxisnah sein müssen. Diese Haltung prägt auch unsere Weiterbildungsangebote, in denen wir Digitalisierung, Unternehmertum und persönliche Entwicklung vernetzen.
Neue Bildungskultur: Diversität in der Lehre der HSLU Informatik
In der Aus- und Weiterbildung an der HSLU Informatik zeigt sich zunehmend: Diversität ist kein Sonderthema – sie ist Realität. Sie ist eine Chance, unsere Programme zukunftsfähig, flexibel und zugänglich zu gestalten.
Ich bin überzeugt: Wenn wir uns trauen, Lehr- und Lernräume jenseits der Mitte zu gestalten – strukturierter, menschlicher, zugänglicher – schaffen wir bessere Bildung.
Wir verwirklichen einen strategischen Anspruch unserer Hochschule: Es geht darum, nicht nur zu lehren, sondern auch zu gestalten.
Wir verwirklichen einen strategischen Anspruch der Hochschule Luzern. Und machen unsere Programme relevanter, verantwortungsvoller und wirksamer – ganz im Sinne einer Bildungsinstitution, die nicht nur lehrt, sondern gestaltet.
Diese Perspektive weiterzuentwickeln – sei es als Dozent, Mentor oder in leitender Funktion – sehe ich als meinen Beitrag zu einer Hochschule, die Menschen bewegt.
Denn was uns neurodivergente Studierende lehren, ist nicht nur didaktisches Feintuning. Es ist eine Einladung zu einer neuen Art von Bildungskultur.
Lehre beginnt beim Zuhören. Nicht beim Planen.

Jan Carlos Janke
Dozent und Senior Wissenschaftlicher Mitarbeiter Digital Business & Innovation an der Hochschule Luzern – Informatik.
Er leitet auch das operative Geschäft der Digital Identity and Data Sovereignty Association (DIDAS-Verein) und managed dieses Ökosystems.
Zum Schluss eine Frage
Ich lade Sie ein, Lehre einmal mit den Augen derer zu betrachten, die wir oft übersehen – und zu fragen: Was brauchen Studierende, damit Lehre für sie Raum wird?
Und was brauchen Dozierende, damit sie diesen Raum gestalten können?
Schreiben Sie Ihren Kommentar oder Ihre Fragen bitte hier zuunterst ins Kommentarfeld.
Weitere Gedanken zum Thema habe ich auch auf LinkedIn festgehalten: Neurodiversität sichtbar machen – Autismus in der Hochschullehre.
Veröffentlicht am: 22.04.2025
Barrierefrei studieren: Die Kontaktstelle «barrierefrei» berät Studieninteressierte, Studierende sowie Angestellte, wenn sie Fragen zum Studieren mit Einschränkungen oder dauerhaften Krankheiten haben. Ihr Ziel liegt darin, Nachteile für Studierende mit Behinderungen zu verringern. Durch den Nachteilsausgleich wird Chancengleichheit gewährleistet, sodass alle erfolgreich und ohne Diskriminierung studieren können. Ein Team von Forschenden der Hochschule Luzern und der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich hat die Auswirkungen dieses Instruments geprüft und herausgefunden: Es funktioniert.
Vielfalt ist ein Gewinn: Die Fachstelle Diversity setzt sich mit Fragen der Vielfalt, der Chancengleichheit und des respektvollen Umgangs auseinander. Sie setzt die Diversity-Policy um, koordiniert verschiedene Projekte und Veranstaltungen und erbringt ausgewählte Dienstleistungen.
Diversity-Beauftragte: Ladan Pooyan-Weihs ist Forscherin, Studienleiterin und Dozentin an der Hochschule Luzern – Informatik. Sie berät Studierende, Mitarbeitende und Dozierende bei allen Fragen, die Diversity betreffen. Dazu gehören zum Beispiel Gleichstellungsfragen, die Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie oder Fragen zur kulturellen Vielfalt.
Gefällt Ihnen unser Informatik-Blog? Hier erhalten Sie Tipps und lesen über Trends aus der Welt der Informatik. Wir bieten Einsichten in unser Departement und Porträts von IT-Vordenkerinnen, Visionären und spannenden Menschen: Abonnieren Sie jetzt unseren Blog!
👀 Aktuelles aus unserem Departement auf LinkedIn.

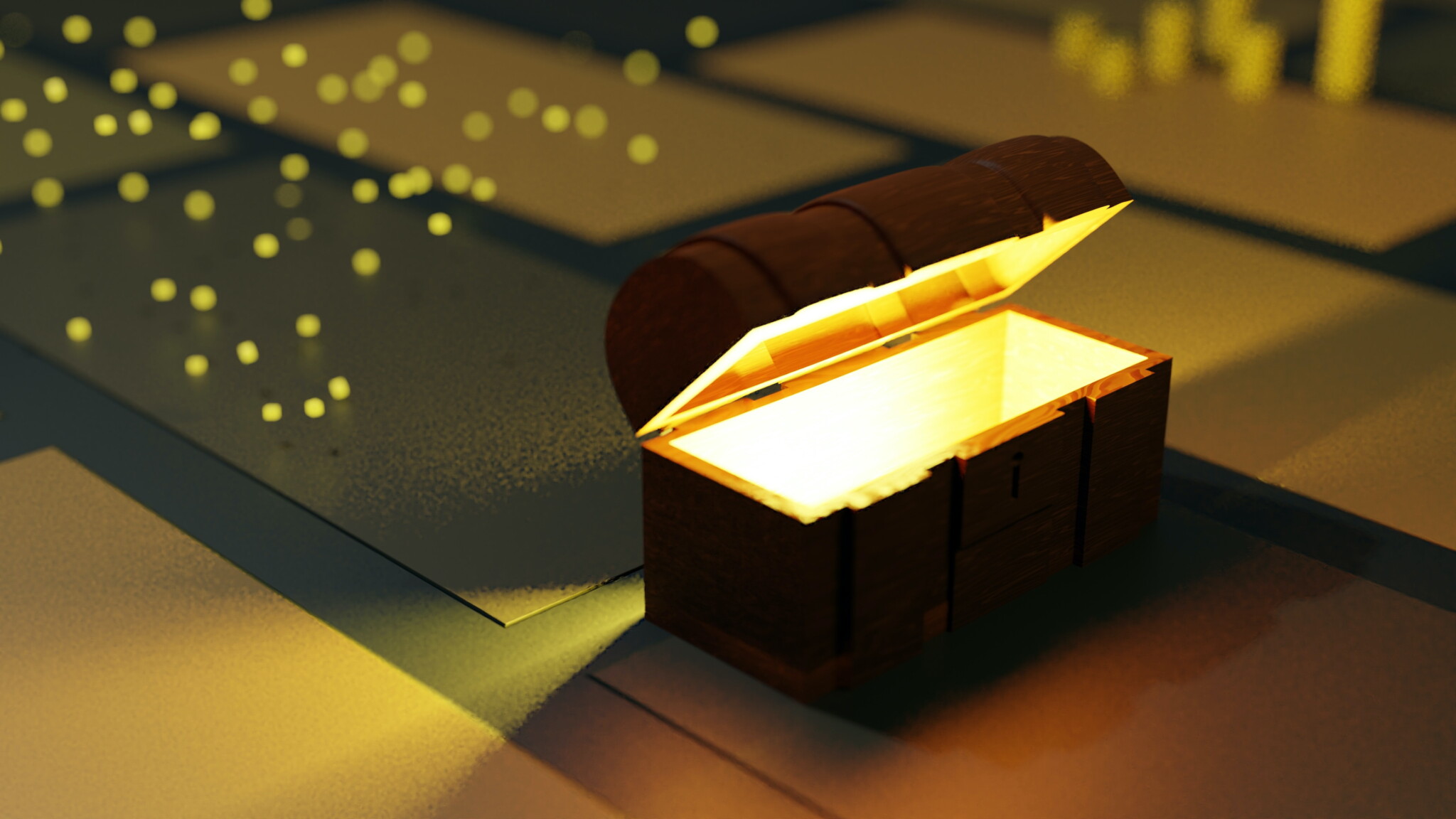

Kommentare
0 Kommentare
Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.